Makerspace: Was passiert in ihnen? Was könnte in ihnen passieren? Zwei Studien
Karsten Schuldt
Zu: Angela Calabresse Barton ; Edna Tan: „STEM-Rich Maker Learning: Designing for Equity with Youth of Color”. New York: Teachers College Press, 2018
Sarah R. Davies: „Hackerspaces: Making the Maker Movement”. Cambridge; Malden: Polity Press, 2017
Makerspaces – obwohl Bibliotheken jetzt schon seit einigen Jahren mit ihnen experimentieren, sie einrichten und auch wieder schliessen, sie in Veranstaltungen ausprobieren, institutionalisieren und eigentlich schon viele Erfahrungen vorliegen, scheinen sie für Bibliotheken doch immer noch viele, viele Versprechen mitzubringen. Immer wieder und wieder machen sich (Öffentliche) Bibliotheken Gedanken, ob sie mit Makerspaces innovativer, zukunftsgewandter, besser, neuer sein können. Diese Versprechen scheinen selten überprüft zu werden und auch eher aus Vorstellungen über Makerspaces und was in diesen passiert gespeist zu werden, als aus der Realität in wirklich existierenden Makerspaces.
In den letzten beiden Jahren sind in Buchform zwei tiefergehende Studien publiziert worden, welche sich aber gerade dieser Frage widmen: Was passiert in Makerspaces tatsächlich? Die eine als eher ethnolographische Studie über normale Maker- und Hackerspaces in den USA, die andere als Action Research über einen spezifischen Makerspace für Jugendliche in einem Community Center in einer sozial benachteiligten Gemeinschaft, ebenso in den USA. Beide liefern einen Einblick, der unter anderem viele Hoffnungen, die sich Bibliotheken auf Makerspaces und ihre Wirkungen machen, bezweifeln lässt – was aber gleichzeitig, wenn sie genutzt werden, auch heissen kann, dass die Makerspaces, die Bibliotheken bauen, realistischer geplant und betrieben werden könnten, wenn man beim Planen und Hoffen auf die Erkenntnisse aus diesen Studien zurückgreifen würde. Beide sollen hier kurz vorgestellt werden.
Der Hackerspace als Raum eines spezifischen Menschenschlages
In einer der beiden Studien, „Hackerspaces: Making the Maker Movement”, untersuchte Sarah R. Davies (zusammen mit Dave Conz) ein Dutzend Makerspaces in den USA, allerdings schon 2012. Die Auswertung dauerte länger, vielleicht hat sich jetzt einiges verändert.1 Trotzdem ist es eine tiefergehende Untersuchung. Die besuchten Einrichtungen wurden genauer untersucht, die erhobenen Daten genauer ausgewertet, als in einfachen Berichten. Der Blickwinkel dieser Auswertung war ein ethnographischer, also einer, der danach fragte, wie die Makerspaces als Gemeinschaft und als sozialer Raum funktionieren. Davies und Conz beschränkten sich dabei nicht auf eine kleine geographische und inhaltliche Auswahl, sondern versuchten, möglichst viel abzudecken, auch möglichst viele unterschiedliche Daten zu erheben. Einzige Einschränkung ist, dass sie Makerspaces untersuchten, die für sich alleine existierten. Zwar wird erwähnt, dass Schulen und Bibliotheken auch Makerspaces aufbauen würden, aber die mit einzubeziehen wäre zu viel gewesen.
Hackerspaces, so wird am Anfang betont, sind motivierend, wenn man sie das erste Mal betritt. Sie vermitteln den Eindruck von emsiger Tätigkeit und Offenheit. Aber, so lässt sich schnell sehen, so einfach ist es dann doch nicht. Was die Makerspaces in der Studie eint, ist, dass sie sich zwar alle grundsätzlich als offen verstehen, als leicht zugänglich und auch einem Diskurs von Innovation, Bildung und Demokratisierung folgen, es bei näherem Hinsehen doch nicht sind. Davies verweist mehrfach auf den Widerspruch zwischen dem Diskurs – der auch nicht unbedingt von den Makerspaces selber produziert wird, aber den sie bedienen – und der Realität.
Die Personen, welche die Makerspaces wirklich nutzen, sind viel eher an individuellen Projekten und Erfahrungen interessiert. Sie wollen für sich lernen, etwas ausprobieren und so weiter. Diese Interessen treiben ihre eigene Beteiligung an den jeweiligen Makerspaces, nicht oder nur sehr im Hintergrund übergreifendere Interessen. Solche eigenen Interessen sind dann auch die soziale Eintrittskarte in die Communities der Makerspaces: Nur, wer eigene Projekte hat, wird als wirklich interessiert angesehen. Nur dann wird einem oder einer auch wirklich geholfen. Der freie Wissensaustausch, welche im Diskurs um Makerspaces als deren Eigenheit prominent betont wird, ist so nicht zu finden: Wissen wird geteilt, aber nur im Rahmen von Projekten, nur als Hilfe zur Selbsthilfe bei diesen Projekten.
Einige Makerspace sind sehr private Unternehmungen – in privaten Garagen, im privaten Freundeskreis -, andere sind grösser, organisiert als Vereine oder ähnlicher Strukturen. Im Rahmen dieser Voraussetzungen sind sie immer auf der Suche, ihre Mitgliedschaft zu erweitern. Wieder: Grundsätzlich betonen alle ihre Offenheit, aber die Realität ist etwas anders. Es gibt keine direkte Ausgrenzung, aber Voraussetzungen: Nur, wer selber Projekte mitbringt, an denen er oder sie arbeiten will, wird sozial akzeptiert. Durch die Makerspaces hindurch fand Davies Abgrenzungen zu Menschen, „die es nicht verstehen”, die vorgeblich „in der Konsumgesellschaft leben und damit glücklich sind”. Das ist selbstverständlich eine subjektive Einschätzung, welche aber Strukturen reproduziert: Wer kommt denn auf die Idee, Projekte zu machen? Wer lernt solch eine Vorgehen zu die eigene Identität zu inkorporieren? Wer kann sich Projekte vorstellen, die auch noch mit Technik umzusetzen sind? Eher die, die bestimmte Voraussetzungen im Leben hatten und haben. Die Makerspaces, welche Davies untersucht, sind – wohl wegen diesen Strukturen – geprägt von mittelalten, situierten, oft weisse Männern. Nicht vollständig, es gibt auch immer wieder einige andere Personen. Aber wenige. Nur die Makerspaces, die sich explizit darum bemühen, schaffen es, Frauen oder Personen mit einem anderen sozialen Profil anzusprechen. Ansonsten reproduzieren sie, ungewollt und trotz anderem Diskurs, gesellschaftliche Ausgrenzungen.
Auffällig ist auch, dass die Communities, welche sich um Makerspaces bilden, nicht einfach wachsen. Es ist immer eine Aufgabe in den Makerspaces selber, die Communities zu erhalten. Irgendwer muss immer diese Arbeit leisten. Dabei wird, so wieder Davies, in den Makerspaces in einer Art kommuniziert – sowohl inhaltlich als auch technisch – wie sie in anderen nternetbasierten Subkulturen auch vorkommt: Es geht immer darum, „Drama” zu vermeiden, Regeln auszuhandeln und Konflikte zu überwinden. Keine dieser Makerspace-Communities funktioniert von alleine.
Ein Community-basierte Makerspace muss offenbar anders funktionieren
Einer der Makerspaces, die es schaffen, andere Personen anzusprechen, wird in der Studie von Calabrese Barton und Tan, „TEM-Rich Maker Learning: Designing for Equity with Youth of Color”, vorgestellt. Dieser ist in einem ungenannten Community-Center in einem ärmeren Stadtteil in den USA untergebracht und wird von diesem Center auch finanziert und getragen. Die beiden Forschenden arbeiteten in einem Action Research Project zwei Jahre in diesem Makerspace mit jüngeren Jugendlichen, welche das Center nutzten.2 Das Vorgehen von Action Research – mit den Personen, über die geforscht wird, für diese sinnvolle Aktivitäten planen, durchführen, dann diese reflektieren und iterativ Theorie bilden, um wieder Aktivitäten zu planen und so weiter – führte zu einem etwas schwerfälligem Text, der immer wieder in kleinen Schritten reflektiert und immer wieder die gleichen Beispiele heranzieht, um Aussagen zu demonstrieren. Lässt man sich davon aber nicht abschrecken, so erhält man eine Einblick darin, das Makerspaces auch anders sein könnten, als die bei Davies beschriebenen – aber nur, wenn man dies explizit einfordert und die Arbeit dafür leistet.
Calabrese Barton und Tan stellen – unabhängig von Davies, eher durch die Lektüre von Literatur zu Makerspaces, insbesondere die omnipräsente Zeitschrift „Make:” – den gleichen Widerspruch zwischen den im Diskurs behaupteten Potentialen von Makerspaces und der Realität in diesen fest. Gleich zu Beginn ihres Buches betonen sie, dass die Projekte, welche in der Literatur immer und immer wieder präsentiert werden, vor allem individualistische Experimente darstellen, die vielleicht aus Interesse am Ausprobieren durchgeführt werden, die aber keine Probleme lösen. Wer wird damit angesprochen? Nicht die Jugendlichen aus der Gegend mit sozialen Problemen, mit denen Calabrese Barton und Tan arbeiteten und die im Alltag vor allem mit realen Problemen fertig werden müssen, andere Ästhetiken und Regeln entwickeln, als die in „Make:” präsentierten – also nicht solchen aus dem abgesicherten Mittelstand.
Aber: Es ist sehr wohl möglich, diesen Jugendlichen mit einem Makerspace Möglichkeiten zu eröffnen – mit einer anderen Form von Makerspaces und Arbeit im Makerspace. Wie sieht diese aus? Zuerst müssen die Jugendlichen ernst genommen werden und sich willkommen fühlen. Die beiden Autorinnen besuchten mit den Jugendlichen ihrer Studie eine ganze Anzahl von existierenden Makerspaces – und obwohl sie dort gut aufgenommen und informiert wurden, obwohl sie die ganzen Maschinen und Techniken positiv wahrnahmen, waren sie anschliessend der Meinung, dass sie dort eigentlich nicht wirklich willkommen wären. Diese Makerspaces wären nichts für sie: Zu wenig Kinder- und Jugendfreundlich, zu viele Verbote und Regeln, zu wenig andere Möglichkeiten als nur an Projekten zu arbeiten.
Zudem müssen die Makerspaces die Jugendlichen tatsächlich empowern, also Dinge umsetzen lassen, die für sie Sinn haben und ihnen zeigen, dass sie Macht haben. Die Jugendlichen entwarfen auf der Basis ihrer Besuche einen Makerspaces „für uns” – mit Orten „zum Denken” (Couch, Trampolin), viel bunter als die zuvor besuchten Makerspaces, nur mit Technik, die auch wirklich alle bedienen dürfen, räumlich direkt neben anderen Angeboten des Community-Centers (und damit nicht auf das rein Abarbeiten von Projekte bezogen). Anschliessend überzeugten sie das Board des Community-Centers, diesen Makerspace tatsächlich einzurichten.
Anschliessend müssen im Makerspace klare Strukturen vorhanden sein (regelmässige Sitzungen), aber so flexibel, dass sie in das eher krisenhafte Leben der Jugendlichen passen (umgesetzt als ständige Möglichkeit, zwischendurch to drop-out und dann nach Wochen, Monaten wiederzukommen und weiter zu machen).
Weiterhin müssen die Projekte Sinn für die Jugendlichen machen. Sinn machen sie, wenn sie in der Realität verankert sind. Im Projekt wurde das umgesetzt, indem die Jugendlichen selber ihre Umgebung erkundeten, Interviews führten, Probleme identifizierten, welche tatsächlich vorliegen. Und dann daran gingen, diese mit ihren Projekten zu lösen, immer im Hinblick darauf, dass sie auch wirkliche Veränderung ermöglichen würden. Nicht, dass man etwas basteln und werkeln würde war wichtig, sondern dass damit eine Lösung geschaffen würde (ein Fussball, der leuchtet, weil Fussballplätze in der Umgebung unbeleuchtet sind; eine „Anti-Bullying”-Jacke mit Alarmknopf; eine Handyhülle mit Solarzellen zum Aufladen von Smartphones auch ohne Stromrechnung). Alle das muss angeregt und unterstützt werden.
Zusammen war es zumindest in den zwei untersuchten Jahren möglich, einen Makerspace für Jugendliche zu betreiben, die nicht zum normalen Klientel von Makerspaces gehören – aber nur, indem überhaupt einmal als Problem benannt wird, dass die angebliche Offenheit von Makerspaces sich in der Realität nicht findet und das die notwendige Arbeit geleistet wurde, die Jugendlichen aktiv zu integrieren.
Hoffnungen von Bibliotheken auf die Wirkung von Makerspaces: Revisited
Was heisst das nun bezogen auf Öffentliche Bibliotheken (im DACH-Raum)?
-
Die Gesellschaft, die Machtstrukturen der Gesellschaft, all die Aus-und Einschlüsse, sind vorhanden und lassen sich nicht einfach abstellen, wenn man einen Makerspace einrichtet. Insbesondere, wenn man den Makerspace „einfach laufen lässt”, läuft man sehr schnell Gefahr, diese Strukturen wieder zu reproduzieren, gar zu verstärken. Der Makerspace produziert da keine neue Offenheit.
-
Die Community, von der sich oft versprochen wird, dass sie sich um Makerspaces bildet: Das ist zweifelhaft, wieder vor allem dann, wenn man den Makerspace „laufen lässt”. Es ist immer Arbeit, Community herzustellen und zu erhalten, auch Arbeit, die immer wieder scheitert. (Das könnte man auch so aus der Ethnologie lernen, aber das ist hier einmal nicht Thema.) Sie entsteht nicht nebenher und wenn doch eine entsteht, aber man nicht aufpasst, entsteht eine, die auch sehr ausgrenzt.
-
Ein Makerspace, der vor allem auf Technik und Ausprobieren dieser Technik setzt, scheint auch eher zu individualistischen Projekten und zur individualistischen Nutzung des Angebots zu führen. Die Frage für Bibliotheken ist: Ist das so gewollt? (Alle anderen Schlagwörter aus den Diskursen um Makerspaces wie Innovation oder mehr Bildung oder neue Bildung oder Unterstützung der lokalen Ökonomie – all das findet sich in der Realität von Makerspaces offenbar nicht wirklich.)
-
Technik alleine, egal wie hip, reicht nicht aus, um erfolgreich einen Makerspace zu betreiben.
-
Zusammengefasst läuft man mit Makerspaces, vor allem solchen ohne zusätzliches Personal, immer Gefahr, noch einen weiteren „Mittelstands-Raum” zu bauen. Das ist nicht Öffnung der Bibliothek „zur Stadtgesellschaft” oder so, von der Bibliotheken aktuell reden.
-
Andere Makerspaces oder Angebote im Bereich Makerspace sind aber offenbar möglich: Nur ohne Personal dafür, dass darauf achtet, dass der Makerspace halt nicht zum „normalen” wird, ist eher zweifelhaft, ob sie etwas anderes sein können, als ein Raum, indem die gesellschaftlichen Strukturen reproduziert werden.
Fussnoten
1 Was sich verändert hat, ist, dass die Firma „TechShop”, welche das Makersapce-Modell kommerziell umsetzen wollte (also Räume gründete, die wie Co-Working-Spaces tage-, wochen- oder monatsweise gemietet werden konnten) und in Hochzeiten zehn US-Filialen und vier internationale Filialen betrieb – und von der sich andere Makerspaces, die Davies untersuchte, immer und immer wieder abgrenzten – 2014 Konkurs anmeldete.
2 Wenn sie den konnten. Ein Fakt, der die Armut der Jugendlichen demonstriert, ist, dass eine Anzahl von Ihnen nicht kontinuierlich an den Sessions im Makerspace teilnehmen konnte, weil sie sich die Busfahrt nicht leisten konnten.
Von Digitalfundamentalisten und Zentralisierungswünschen
Zu: Michael Knoche (2018): Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft (2. Auflage). Göttingen: Wallstein, 2018
Karsten Schuldt
„Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft” ist ein Buch, welches stark an Polemik, aber inhaltlich weder überzeugend noch konsistent ist.
Von Beginn an: Der Autor, Michael Knoche, war lange Jahre (inklusive der Zeit des Brandes und Wiederaufbaus) Direktor der Anna Amalia Bibliothek in Weimar und scheint als solcher eine starke Meinung zu verschiedenen Themen des Wissenschaftlichen Bibliothekswesens entwickelt zu haben. Im genannten Buch versucht er, diese zu vermitteln. Selbstverständlich ist er dabei fachkompetent.
Das Buch selber ist erstaunlich kurz. Die einzelnen, 16 Kapitel sind jeweils vielleicht 5 Seiten lang. Zudem ist es an vielen Stellen unterhaltsam zu lesen: Der Autor versucht sich immer wieder in Polemik und Sprachbildern, die nicht immer funktionieren, aber von Überzeugungen zeugen.
Was der Autor allerdings sagen will und vor allem, gegen wen er anschreibt, das ist schwer fetszustellen. Ebenso schwer ist zu sagen, an wen er sich eigentlich richtet. Vom Thema ausgehend könnte vermutet werden, dass er ins Bibliothekswesen hinein intervenieren will. Viele seiner Andeutungen sind wohl nur für die verständlich, die einen bibliothekarischen Hintergrund mitbringen. Gleichzeitig aber scheint der Autor sich an eine breit Öffentlichkeit oder aber die Politik zu richten, da er ständig Konzepte wie Open Access, Provenienzforschung oder Formen der Fernleihe erläutert, die man im Bibliothekswesen als bekannt voraussetzen kann. Am Ende des Buches ist dann auch nicht klar, von wem er eigentlich was fordert.
Sichtbar ist, dass er eine Personengruppe ablehnt, die er mal „Digitalfundamentalisten” (47 u.a.), mal als „Bibliothekare[, die] unter einer rätselhaften Form des Bücherverdrusses [leiden]” (11) bezeichnet. Wer genau zu dieser Gruppe gehört oder was diese Gruppe genau ausmacht, wird nicht benannt. Einzig Rafael Ball (ETH Zürich) und Rick Anderson (University of Utah) werden genannt, aber das ist keine Gruppe. Man würde vermuten, dass im Laufe des Buches durch Abgrenzungen klar wird, was diesen „Digitalfundamentalisten” vorzuwerfen sei, aber das passiert nicht. Der Autor selber ist überhaupt nicht konsistent in dem, was er positiv oder negativ findet. Er hebt, selbstverständlich, auch ständig Vorteile des digitalen Kommunizierens, Publizierens und Aufbewahrens (also vor allem des Scannes von Büchern) hervor. Er ist also kein Luddit. Vielleicht meint er, dass „Digitalfundamentalisten” einfach immer und überall gedruckte Medien ablehnen würden, was so (die Bücher von Rafael Ball sind z.B. auch gedruckt zu erhalten, ebenso wie die von ihm herausgegeben B.I.T. Online) auch nicht stimmt. Es scheint eher, als hätte der Autor ein Feindbild und würde davon ausgehen, dass wir, die Leserinnen und Leser, dieses ohne grosse Erklärung auch teilen würden. (Zumindest der Rezensent ist gehört nicht zu dieser Gruppe und kann deshalb mit dem Begriff nicht wirklich etwas anfangen.)
Der Titel, der Klapptentext und das einleitende Kapitel des Autors versprechen, über die „Idee der Bibliothek” und die Zukunft der Bibliotheken – eingeschränkt auf die Wissenschaftlichen Bibliotheken – nachzudenken. Davon findet sich im Buch fast nichts. Es wird nicht argumentiert oder nachgedacht, vielmehr scheint der Autor einige Überzeugungen zu haben, die er mitteilen will. Das Problem ist nicht, dass er Überzeugungen hat. Ohne solche wäre vielleicht kein guter Bibliotheksdirektor gewesen. Das Problem ist, dass er nicht einmal den Versuch unternimmt, zu überzeugen. Er scheint auch hier davon auszugehen, dass es keiner weiteren Ausführungen bedürfte, sondern das einfach dadurch, dass er seine Überzeugungen äussert, diese zu Wahrheiten würden. Das hält das Buch kurz, aber es erreicht nur die, die eh schon seiner Meinung sind. Beispielsweise betont er, dass Bibliotheken (alle Bibliotheken) den Auftrag hätten, langfristig und umfassend zu sammeln. (Das ist dann auch schon die „Idee der Bibliothek” aus dem Buchtitel.) In einem Kapitel betont er dann noch, dass nur dieses Sammeln es möglich macht, historisch zu arbeiten, zumal bei sich ständig wandelnden Paradigmen der Geschichtswissenschaft. Aber anschliessend geht er einfach davon aus, dass dies allgemein akzeptierter Fakt sei. Es ist, wie weiter oben gesagt, eine Polemik. Gäbe es aber zum Beispiel die Gruppe der Digitalfundamentalisten wirklich und würde diese auch nur inhaltlich konsistent argumentieren, egal was, wäre sie überzeugender, als dieses Buch.
Die Überzeugungen, welche Knoche vorträgt, sind zudem auch nicht originell. Sie lassen sich in drei Thesen zusammenfassen:
- Aufgabe der Bibliotheken ist das umfassende und nachhaltige Sammeln
- Digitalfundamentalisten würden diese Aufgabe bedrohen (weil das Digitale nicht einfach zu sammeln wäre, sondern – weil es ja Lizenzen sind – gesonderter Regeln bedürfe und selbstverständlich einer Klärung, wie man überhaupt Digitales nachhaltig sammeln kann; alles Fragen, die im Bibliothekswesen auch ohne die Polemik dieses Buches besprochen werden): „Nur wenn die Sammlungen ihr Eigentum sind, können sie [die Bibliotheken] versuchen, sie dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Bibliotheken müssen Bestand halten.” (9)
- Notwendig sei eine Zentralisierung von Aufgaben, entweder durch zentrale Einrichtungen (Knoche meint, dass die DFG dies nicht – mehr – tun würde oder könnte, sondern der Bund eingreifen müsste) oder aber durch enge Kooperation der Bibliotheken (wobei er dann für Bibliotheken mehr Autonomie fordert und – offenbar ohne Kenntnis der tatsächlichen Lage in der Schweiz – unter anderem die schweizerischen Bibliotheken als positives Beispiel darstellt)
Gerade diese letzte Idee einer nationalen Koordination der bibliothekarischen Aufgaben scheint Knoche umzutreiben. Aber auch hier: Das wird nicht begründet, es wird einfach behauptet, dass es anders nicht mehr möglich wäre, zu sammeln. Gezeigt oder gar nachgewiesen wird das nicht. Die reine Behauptung vonseiten des Autors soll offenbar alleine ausreichen. Ausgehend von dieser Behauptung fordert er dann – allerdings unklar, von wem – wieder einmal eine Nachfolgeeinrichtung des Deutschen Bibliotheksinstituts und eine Wiedereinführung der langfristigen Finanzierung der Sondersammelgebiete.
Wie gesagt: Dieses Buch überzeugt wohl niemand von irgendetwas. Es liefert auch, ausser dem polemischen Begriff der Digitalfundamentalisten (übrigens durchgängig männlich, deshalb auch in dieser Besprechung so zitiert), keine neuen Ideen. In einigen Bereichen sind die Überzeugungen des Autors auch erstaunlich konservativ, beispielsweise spricht er sich – aber da ist er mit anderen Autoren des herausgebenden Wallstein Verlages, wie Uwe Jochum einer Meinung – gegen eine Verpflichtung von Forschenden zu Open Access aus, weil dieses die Wissenschaftsfreiheit einschränken würde. Vielleicht spiegelt es die Überzeugungen vieler deutscher (?) Bibliotheksleitungen wider. Wenn dem so wäre, würde es aber auch eine Schwäche dieser Überzeugungen offenlegen, nämlich dass sie nicht argumentativ oder mit Fakten untermauert sind.
Es ist aber, wie gesagt, vergnüglich zu lesen. Aber eher wie ein Grime-Track, dem man wegen der Sprachbilder und dem gekonnten Springen durch die Themen und Beleidigungen Respekt zollt, nicht wegen des Inhalts.
Kann die Luftfahrtindustrie ein Vorbild für das wissenschaftliche Publizieren sein?
Eine Kritik von Ben Kaden (@bkaden) zu
Toby Green: We’ve failed: Pirate black open access is trumping green and gold and we must change our approach. In: Learned Publishing. Early View. 6. September 2017 DOI: 10.1002/leap.1116 (Der Beitrag kann auch ScieneOpen diskutiert werden.)
Zusammenfassung
Ausgangspunkt der Argumentation ist die These, dass sowohl der goldene als auch der grüne Weg des Open Access mehr oder weniger als gescheitert gelten müssen. Eine grundsätzliche strukturelle Veränderung, wie sie die Bedingungen des digitalen Publizierens in der Wissenschaft erfordern, haben sie nicht bewirken können. In diese Lücke ist Sci-Hub mit seinem „Black Open Access“ eingedrungen und hat, so Toby Green, damit Tatsachen geschaffen, die die Bemühungen um Grün und Gold im Prinzip obsolet werden lassen. Die Ursache dafür sieht er darin, dass die notwendigen Änderungen im Publikationssystem nicht von allen sechs Stakeholdern – Autoren, Heimatinstitutionen der Autoren, Forschungsförderung, Bibliothekaren, Verlagen, Lesern – gleichermaßen mit getragen und abgestimmt („in concert“) umgesetzt werden. Als Lösung schlägt er eine Änderung des Geschäftsmodells der Verlage vor. Diese sollten ihre Dienste, analog zum Vorbild der Fluggesellschaften, differenzieren. In dem skizzierten Szenario gibt es einen freien Read-Only-Basisdienst (gratis open access, vgl. Peter Suber, 2007) und Mehrwertdienste für die unterschiedlichen Stakeholder. Auf Autorenseite wären dies Dienste wie Peer Review und Lektorat. Auf der Leserseite könnten dies semantische Anreicherungen, Alert-Dienste und Impact-Messungen sein. Für Bibliotheken stellt sich Toby Green angereicherte Metadaten, Nutzungsberichte und Support-Services vor. Wissenschaftsförderer und Wissenschaftsinstitutionen könnten thematische Fachberichte kaufen. Toby Green spricht an dieser Stelle von einer Demokratisierung der Wissenschaftskommunikation („democrizing scholarly communications“). Durch den Read-Only-Basisdienst ist zu erwarten, so seine These, dass Sci-Hub überflüssig wird.
Kritik
Das Gedankenspiel ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Toby Green vernachlässigt, dass das System des Goldenen und auch des Grünen Weges für die Stakeholder über weite Strecken funktioniert. Die hohen wissenschaftsethischen Ziele diverser Erklärungen wurden nachweislich nicht eingelöst. Dennoch ist Open Access keinesfalls gescheitert und funktioniert in bestimmten Communities exzellent.
Sci-Hub wird zwar als Konkurrenz angesehen und auf dem Rechtsweg sowie diskursiv verfolgt. Die Popularität der Schattenbibliothek hat jedoch keinen Open-Access-Hintergrund aus wissenschaftsethischer Sicht sondern beruht unter anderem darauf, dass es einen Großteil der über DOIs adressierbaren Literatur an einer Stelle abrufbar macht. Relevant sind hierbei vor allem Closed-Access-Publikationen. Sci-Hub wird zudem erfahrungsgemäß auch oft für Inhalte genutzt, die lokal lizenziert sind bzw. bereits als Gold- oder Green-OA verfügbar sind. Dieser Aspekt der, wenn man so will, Kanalbündelung als Nutzungsanreiz wird in der Argumentation komplett unterschlagen.
Problematisch ist ebenfalls, dass die Mehrwertdienste für die Stakeholder nur als Schlagwörter benannt werden und wenig überzeugen. Ob Autoren beispielsweise bereit wären, für Peer Review zu bezahlen, ist völlig unklar und keinesfalls mit dem Bordverkauf in Flugzeugen zu vergleichen. Für andere Dienste wie Impact-Messungen gibt es bereits einschlägige Dienstleister und Angebote. Hier sind Angebote auf Ebene der Einzelpublisher angesichts des Charakters der Wissenschaftskulturen nicht sinnvoll da zu wenig aussagestark. Alert-Dienste bekommt man bei vielen Wissenschaftsverlagen bereits gratis. Sie sind dort als Teil des Vertriebs etabliert. Die Rolle thematischer Fachberichte übernehmen in vielen Forschungsbereichen so genannte Review-Article, die direkt in den Prozess der Wissenschaftskommunikation eingebunden sind. Inwieweit dies gesondert systematisiert werden kann und sollte, ist ein interessanter Punkt. In bestimmten Bereichen wie der Medizin existieren bereits spezialisierte Dienstleister mit genau diesem Ansatz.
Insgesamt ist die kritiklose Übernahme des Unbundling-Konzepts aus der Luftfahrtindustrie für die wissenschaftliche Kommunikation sehr fragwürdig und für dieses Szenario eher unpassend. Unterschlagen wird, dass bei dieser Praxis vielen Fällen ein erheblicher Komfortabbau und also Qualitätsverlust der, hier buchstäblich, Customer Journey festzustellen ist. In der Praxis sind die Wahlmöglichkeiten der Zusatzdienste oft sehr begrenzt und zugleich überteuert. Der Vorbildcharakter dieser Industrie ist aus Sicht von mindestens vier bis fünf der sechs Stakeholder im wissenschaftlichen Kommunikationssystem schwer nachvollziehbar.
Schließlich bleibt zu fragen, inwieweit das vorgeschlagene gratis Open Access tatsächlich in Einklang mit dem Konzept von Open Access zu bringen ist. Informationsethisch mag der reine und zugleich doch beschränkte Zugang einen Vorteil darstellen, da ein begrenzter Zugang besser als kein Zugang ist. Aus Sicht der Wissenschaftskommunikation, für die Open Access die gleiche Teilhabemöglichkeit alle Autorinnen an den kommunikativen Zyklen von Publikation über Rezeption bis Zitation darstellt, könnte die vorgeschlagene Variante die Situation sogar noch verschlechtern. Toby Green vernachlässigt hier also die Ansprüche und Bedingungen der Wissenschaftler als Kommunikationsgemeinschaft.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Es ist allen in diesem Feld Aktiven bewusst, dass Open Access bisher keine allgemeine überzeugende Form gefunden hat. Der Vorschlag von Toby Green weist jedoch aus den oben benannten Gründen keine fruchtbare Perspektive hinsichtlich einer denkbaren Lösung auf.
(Berlin, 12.09.2017)
Von „sozialisierten Drucken“ zu „Raubdrucken“ (plus: Geschichte des linken Buchhandels ’68 bis in die 80er)
Zu: Uwe Sonnenberg. Von Marx zum Maulwurf: Linker Buchhandel in Westdeutschland in den 1970er Jahren (Geschichte der Gegenwart, Band 11). Göttingen: Wallstein Verlag (2. Auflage), 2016
von Karsten Schuldt
Das hier zu besprechende Buch hat an berufeneren – nämlich auf Geschichtsschreibung, Literatur- und Gesellschaftskritik fokussierten – Stellen sehr gute Kritiken erhalten (zum Beispiel hier, hier, hier und hier) und das nicht zu Unrecht. Der Autor beschreibt in dieser Dissertation – die auch in dieser Ausgabe immer noch eine solche, mit all den hunderten Fussnoten, ist – die Entwicklung des linken Buchhandels – hier gefasst als Buchhandlungen, Verlage, (Sozialistische) Verlagsauslieferung und am Rand Druckereien – in der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem Entstehen einer eigenständigen, grossen linken Szene um 1967 bis in die früher 1980er Jahre. Diese Beschreibung ist materialreich, der Text selber etwas mehr als 500 Seiten lang. Orientiert ist die Beschreibung am Verband des linken Buchhandels (VLB), was zum Beispiel die von der DDR unterstützten Buchhandlungen der DKP (Deutsche Kommunistische Partei) ausschliesst, welche nur am Rand erwähnt werden. Nicht wirklich Thema sind zudem die Autorinnen und Autoren der Literatur, die in diesem linken Buchhandel gedruckt und verbreitet wurde.
Die untersuchte Zeit war eine, nur für die linke Szene genommen, ereignisreiche. Vom Aufbruch und der Hoffnung, dass bald alles besser wird, Ende der 1960er, über die Selbstauflösung des SDS, dass Entstehen der zahllosen K-Gruppen, deren Zerfall und dem Entstehen neuer Szenen und Infrastrukturen, insbesondere der Autonomen und des Neo-Anarchismus, der Stadtguerilla bzw. Terrorgruppen, insbesondere der RAF, bis hin zur Ausdifferenzierung der neuen sozialen Bewegungen. Auch theoretisch kein kleiner Bogen: Von der Wiederentdeckung marxistischer und anarchistischer Klassiker, inklusive der nicht-stalinistischen Traditionen und Vorläufer (Frankfurter Schule, Sexpol, Rätekommunismus, Trotzkismus etc.), über die zeitgenössischen Marxismen (Histomat und Diamat, Maoismus, Titoismus etc.) bis hin zum Poststrukturalismus und der eigenständigen Theoriebildung der neuen sozialen Bewegungen (Umweltbewegung, Feminismus in seinen unterschiedlichen Formen etc.). Oder anders: Eine Zeit mit vielen Experimenten, Bewegung, Hoffnungen, Sackgassen und Neuanfängen. Und mittendrin der Buchhandel mit Projekten, die sich als Teil dieser Bewegung begriffen, teilweise als direkt involviert, teilweise als überparteilich. Insbesondere vor den 1980ern auch immer wieder mit Versuchen, nicht einfach linke Literatur zu produzieren und zu verbreiten, sondern auch gleich die Arbeit anders zu organisieren und nicht als reinen Broterwerb zu verstehen. Der VLB als Verband machte dieses ganzen Entwicklungen auch intern mit, von massiven Aufschwung am Anfang über partei-ähnliche Strukturen und eine interne Spaltung bis hin zum Aufgehen in lokalen Netzwerken.
Erstaunlich brav
Das alles stellt der Autor dar, schon alleine durch die Zeit und die Bewegung ist es interessant. Er macht auch klar, dass das Feld der radikalen Linken – allen immer wieder auftretenden Tendenzen, es von aussen, oft polemisch, als ein gemeinsames Feld zu beschreiben – schon immer stark untereinander differenziert war. Gleichwohl ist das Buch, gerade dafür, erstaunlich brav erzählt. Nicht nur chronologisch (was sinnvoll ist, um das Material zu ordnen), sondern auch erstaunlich faktisch und kurz angebunden. Es ist nicht defamatorisch: So absurd die jeweilige Kleingruppe, über die berichtet wird, auch ist, sie wird nicht bewertet, sondern ernst genommen. (Ausser der RAF, deren Position angesprochen, aber der so viele Positionen gegenübergestellt werden, dass klar ist, dass ihre Entwicklung abgelehnt wird.) Dabei werden auch grosse Entwicklungen und Beschlüsse in wenigen Absätzen erzählt.1 Alles in allem macht das Buch, trotz seiner Dicke, einen erstaunlich gehetzten Eindruck.
Dabei verzichtet der Autor sogar darauf, die Diskussionen und Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen darzustellen. Man erfährt, dass sich (kein Witz) die KPD/ML intern in eine KPD/ML-Zentralkomitee und die KPD/ML-Zentralbüro spaltete, weil dies Einfluss auf einige Buchhandlungen hatte; aber nicht, wieso. Das muss man sich bei Interesse selber erarbeiten, genauso wie andere Differenzen und Diskussionen. Es wird zum Beispiel auch nicht hergeleitet, wie Teile der feministischen Bewegung zu der Überzeugung gelangten, dass sie eigene Frauenräume aufbauen müssten, sondern es wird einfach dargestellt, wie und wann Frauenbuchläden gegründet wurden, die diesem Anspruch folgten (was für den VLB Konsequenzen hatte, da er als Verband unter anderem den Anspruch hatte, Konkurrenz zwischen linken Buchläden auszuschliessen, während einige der Frauenbuchläden argumentierten, dass sie das durch ihren Fokus nicht tun würden, selbst wenn sie sich in der Nähe eines anderen Buchladens einrichteten). Die gesamte Darstellung ist sehr fokussiert.
Vor allem interessant, weil nicht bekannt
Es gibt in dieser Geschichte viele interessante Aspekte. Die Versuche in Buchhandlungen und Verlagen das Arbeiten anders zu organisieren, waren, trotzdem man ihnen teilweise eine grosse Naivität unterstellen will, zum Teil erstaunlich weitreichend. Der – frühe – Merve Verlag hatte zum Beispiel den Anspruch, dass nur verlegt wird, was sich auch inhaltlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet wurde, was zu mindestens drei Plena pro Woche, nach der eigentlichen Arbeit, führte. Andere Verlagen formulierten den Wunsch, aus der kritischen Literatur, die sie verlegten, auch selber etwas zu lernen. Es gab immer die Hoffnung auf ein nicht-entfremdetes Arbeiten im Kollektiv. Gleichzeitig gab es auch immer wieder Buchhandlungen, die sich als Agitationszentrale einzelner Gruppen verstanden.
Beachtlich auch, wie sich Buchhandlungen zu Informationspunkten der Szene entwickelten, die nicht nur Bücher verkauften, sondern eine Infrastruktur anboten und Kristallisationspunkte für die Szene darstellten.( Man ist beim Lesen unwillkürlich daran erinnert, dass Öffentliche Bibliotheken heute gerne behaupten, Zentren der Gesellschaft darstellen zu wollen und fragt sich, ob sie das je so weitgehend erreichen können, wie es der linke Buchhandel zum Teil für „seine Szene“ geschafft hat.)
Die Bibliotheken, nein eigentlich: Der Börsenverein
Bibliotheken kommen in diesem Buch kaum vor. Interessant ist vielleicht die Bemerkung, dass die Bibliothekstantiemen auch in dieser bewegten Zeit, 1973, durchgesetzt wurde, allerdings nicht vom Linken Buchhandel, sondern eher vom Verband der Schriftsteller (VdS), die an einen Diskurs, der auch den Frankfurter Buchmessen 1967 und 1968 auch durch protestierende Vertreterinnen und Vertreter der Verlage („Literaturproduzenten“) etabliert wurde – nämlich das alle am Prozess der Herstellung von Literatur Beteiligten an dieser mitwirken und von dieser profitieren sollten –, anknüpften. Auch diese Regelung ist nicht selbstverständlich, sondern hat eine Geschichte.
Eine Geschichte aus dem Buch aber ist für das Bibliothekswesen interessant, zumindest sollte sie es sein. Sie handelt vom Verhalten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, einer Vereinigung, um die Bibliotheken (in Deutschland) nicht herumkommen und zu dem sie je nach Thema ein gutes oder ein gespanntes Verhalten haben. Allein wegen dieser Geschichte lohnt sich die Lektüre des Buches, zumindest eine oberflächliche.
Bevor der linke Buchhandel sich mit eigenen Verlagen und Buchhandlungen etablierte, begann er in den Mensen der Universitäten Westdeutschlands und Westberlins mit Büchertischen. Diese waren vor allem mit – je nachdem, wen man fragt – „Raubdrucken“ oder „sozialisierten Drucken“ bestückt, Nachdrucken von (zuerst) vergriffenen oder kaum zu beschaffenden Texten, die zum Beispiel aus Bibliotheken oder Antiquariaten besorgt wurden. Später wurden auch, durchaus mit politischer Forderung, Texte nachgedruckt, die sehr wohl zu beschaffen waren, aber nach Ansicht der druckenden Kollektive zu teuer wären. Wenn die Texte zur Theoriebildung für die Revolution benötigt würden, müssten sie auch von allen gelesen werden können, nicht nur von denen, die sie sich in teuren Ausgaben leisten könnten. Zudem hätte Verlage nicht das alleinige Recht, zu bestimmen, welche Bücher veröffentlicht und nicht veröffentlicht würden. Sie beriefen sich dabei auch auf Selbstverlage wie die von Büchner, Lessing oder Klopstock.
Man kann diese Argumente als vorgeschoben bezeichnen und ihre Ernsthaftigkeit bezweifeln (was auch schon damals getan wurde), dennoch ist nicht zu bestreiten, dass diese Texte für die radikale Linke in Deutschland relevant waren. Die Dialektik der Aufklärung war 1967, aufgrund des Einspruchs von Max Horkheimer, nicht greifbar, ausser in diesen Nachdrucke. Klassische Texte des Anarchismus – oder auch nur solche zur Kommune von Kronstadt – oder der linken Opposition zur KPD in der Weimarer Republik waren nur so greifbar. Die heutige Linke mit ihren autonomen Ansprüchen ist ohne diese nicht Literatur nicht mehr vorstellbar.
Diese Nachdruckerei / Raubdruckerei etablierte sich mit der Zeit. Ganze Kollektive verschrieben sich ihr als Arbeit, die nicht so entfremdet sei, wie in der Fabrik und gleichzeitig die Revolution fördern würde. Die Kommune 1 finanzierte sich zum Beispiel zum Teil damit. Und, darauf weist das Buch auch hin, dies war keine reine Untergrund-Szene. Als sich die Kollektive etablierten – mit Adressen und Bestelllisten –, begannen auch normale Buchhandlungen bei Ihnen zu bestellen. Die Drucke zeigten ein Interesse an linker Literatur an, auf die dann einige Verlage massiv reagierten (Suhrkamp, Rowohl, Luchterhand, Europäische Verlagsanstalt). Die ersten Verlage der neuen Linken entstanden aus diesen Kollektiven, auch weil irgendwann die zu „entdeckenden“ Texte zu grossen Teilen entdeckt und neu entstandene Literatur verlegt werden sollte.
Ende der 1960er Jahre begann sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels für das Thema zu interessieren. Zwar waren von den „sozialisierten Drucken“ vor allem selber linke und links-liberale Verlage betroffen, also bei weitem nicht alle Mitglieder des Börsenvereins, aber das hinderte ihn nicht daran, sie als Angriff auf das Copyright selber zu interpretieren. Obwohl Anfang der 1970er Jahre in der Öffentlichkeit ein eher lockerer Umgang mit dem Thema „Raubdrucke“ herrschte, arbeitete der Börsenverein daran, den Diskurs öffentlich und vor gesetzlich zu ändern. (Das erinnert nicht sehr an die Situation vor einigen Jahren, als die Musik- und Filmindustrie das eigentlich gesellschaftlich stark etablierte Kopieren (Privatkopie) von Musik und Filmen zu unterbinden suchte. Die Argumente und das Vorgehen war, wie gleich zu sehen sein wird, sehr ähnlich.)
Es wurde durch den Börsenverein ein Szenario aufgebaut, bei dem Behauptungen über angebliche Verluste von Verlagen durch den „Raubdruck“ aufgestellt wurden, die an sich nicht haltbar waren; es wurde angestrebt, im Bundesinnenministerium ein Sonderdezernat „Raubdrucke“ bilden zu lassen und es wurde ein Privatdetektiv angeheuert, der die angebliche Szene hinter den Raubdrucken ausspähen sollte. Der Diskurs wurde umgedreht: Während die „sozialisierten Drucke“ auch als Kritik am offiziellen Buchhandel gelesen werden konnten, der notwendige Bücher nicht oder zu teuer verlegte, und oft auf lokaler Initiative entstanden, malte der Börsenverein das Bild einer kriminellen Vereinigung, die nur Profitinteressen („Wirtschaftskriminalität“) hätte. Die – damals auch offen formulierte Kritik – an den Verlagen konnte so ignoriert werden.
Der geannte Privatdetektiv recherchierte tatsächlich einige Lager von „Raubdrucken“, die von der Polizei ausgehoben wurden. Der Börsenverein erklärte diese zu Teilen eines Netzwerks und legte Zahlen vor, die von mehreren Millionen DM an „Umsatzausfall“ ausgingen (indem gefundene Drucke massiv hochgerechnet wurden und – eine bestimmt noch aus den Kampagnen gegen „Raubkopien“ bekannte Argumentation – indem behauptet wurde, dass jede Person, die einen solchen Druck gekauft hätte, sonst eigentlich eine „richtige“ Ausgabe gekauft hätte). Am Ende setzte der Börsenverein seine Sicht politisch durch, konnte die implizite politische Kritik verstummen lassen und stattdessen das Bild von kriminellen Strukturen etablieren. Gleichwohl endeten die meisten Verfahren nicht, wie der ganze Diskurs um „Wirtschaftskriminalität“ vermuten liesse, in Verurteilungen, sondern oft in Freisprüchen oder wenn doch in Verurteilungen, in geringen Geldstrafen. Das Problem war nicht halb so gross, wie behauptet, aber der Börsenverein aber konnte einen Diskurs etablieren, bei dem am Ende er als legitimer Vertreter der Verlage und der Gesellschaft galt. Vielleicht unbewusst agierte er so, wie später dann die Musikindustrie.
Die linken Verlage, auch wenn sie sich gegen die Unterstellungen des Börsenvereins wehrten, waren damals oft schon längst zur Produktion eigener Titel übergegangen und mussten sich auch mit ganz anderen Problemen beschäftigen (insbesondere dem Deutschen Herbst).
Fazit
Wie schon erwähnt ist das Buch vor allem wegen der Geschichte, die es beschreibt, interessant. Es langweilt nicht, sondern hetzt die Leserinnen und Leser regelrecht durch die Geschichten und Zeiten. Selbst mit einem soliden Hintergrund in der radikalen Linken – wenn man zum Beispiel selber diese Buchläden genutzt hat und selber Geschichten über die letzten K-Gruppen erzählen kann – wird man immer wieder einzelne Gruppen, Auseinandersetzungen und Positionen anderswo nachschlagen müssen.
Am Ende versucht der Autor einen Ausblick auf die Zukunft des linken Buchhandels zu geben, der eher sehr kurz und unvollständig ausfällt. Er verweist darauf, dass bestimmte Strukturen weiter bestehen (Sozialistische Buchauslieferung), andere neu entstanden sind (Linke Buchtage in Berlin, Linke Literaturmesse Nürnberg) und sich gleichzeitig das Internet mit all seinen Möglichkeiten (zum Beispiel für das Verbreiten „vergessener“ Literatur, wie einst die „sozialisierten Drucke“) neu entwickelt hat. Das ist schon alles faktisch richtig, aber auch wenig aussagekräftig. Warum ist das jetzt da? Wieso gibt es immer wieder neue Verlage, Zeitschriften, selbst Buchhandlungen, die sich der linken Szene zuordnen lassen? Wieso die, aber nicht (kaum) noch die K-Gruppen? Es ist vielleicht nicht Aufgabe das Autors, als Historiker, das zu beantworten; es wäre eher eine Frage für einen andere Arbeit. (Was allerdings jetzt fehlt, ist eine Geschichte der linken Aufbrüche dieser Zeit im westdeutschen Bibliothekswesen. Es muss sich gegeben haben, unter anderem die Zeitschrift „Kritische Bibliothek“ (1971, 1975-1980) zeugt davon.)
1Die absurdeste ist wohl die, dass der Kommunistische Bund Westdeutschland, seinerzeit die wohl einflussreichste K-Gruppe, 1973 bis 1974 nicht nur viele Gruppen und Zirkel dazu brachte, sich ihm anzuschliessen, sondern auch viele linke Buchläden, um dann September 1974 zu bestimmen, dass diese Buchläden zu schliessen seien, da sie eine falsche Strategie darstellten (sie erreichten nicht die Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern Studierende, obwohl erste der Revolution machen sollten und deshalb anders – mit Literatur-Obmännern, wie die KPD in den 1920ern – erreicht werden mussten). Daraufhin wurden ernsthaft die meisten dieser Buchläden geschlossen, egal wie gut sie sonst funktionierten. Dieser ganze Ablauf nimmt im Buch zehn Seiten ein und ist quasi schon vorbei, bevor man das Ausmass dieses Vorgangs begreift.
Ein Seminarskript, ehrlich gesagt
Zu: Reckling-Freitag, Kathrin / Bibliothekspädagogische Arbeit: Grundlagen für Mitarbeiterinnen in (Schul-)Bibliotheken. Schwalbach/Ts. : debus Pädagogik, 2017
von Karsten Schuldt
Das zu besprechende Buch ist kurz, deshalb kann auch die Besprechung kurz sein. Um gleich eine Kritik vorwegzugreifen: Der Titel ist viel zu gross für das, was im Buch eigentlich getan wird. Was der Titel verspricht, ist eine Darstellung von Grundlagen zur „Bibliothskspädagogischen Arbeit“; was das Buch liefert. sind die kommentierten Skripte einer Lehrveranstaltung zum Thema, welche von der Autorin an der HAW Hamburg gegeben wird. Dabei ist auch der für das Thema gewählte Begriff ein wenig zu gross.
Worum es geht, ist, einen Überblick zu geben über die Themen, die für eine bibliothekarische Veranstaltung, welche im weiteren Sinne dem Bildungsbereich zuzuordnen ist, zu beachten sind. Dabei wird die Autorin an einigen, praktischen Punkten, sehr kleinteilig – zum Beispiel bei der konkreten Zeitplanung einer Veranstaltungen – und an anderen Punkten recht oberflächlich – ob es zum Beispiel überhaupt eine spezifische Pädagogik für Bibliotheken gibt, das wird einfach vorausgesetzt. Dass das Buch ein Unterrichtsskript ist, zeigt sich auch an den jedem Kapitel vorangestellten Lernzielen (meist zwei Anstriche), den häufig eingesetzten Graphiken, die einen schon erläuterten Sachverhalt nocheinmal darstellen und den häufigen Praxisaufgaben, bei denen das gerade Erläuterte angewandt werden soll. Gerade diese Aufgaben machen das Buch sehr Hands-on. Es ist nicht einfach durchzulesen, sondern – so zumindest die offensichtliche Vorstellung hinter dieser Struktur – Schritt für Schritt mit einzelnen Übungen durchzugehen. Und sicherlich sind die Aufgaben und der Aufbau des Buches so, dass sie Lernende bei ihrem Lernen unterstützen – schliesslich ist es als Skript schon mehrfach in der konkreten Lehre genutzt worden.1
Das Buch streift Themen vor allem: Aufbau des Bildungssystems, Lerntheorien (sehr kurz), Themen, die in Bibliotheken als Thema von Bildungsveranstaltungen sinnvoll sein können, Aufbau von Lehrveranstaltungen, Durchführungen von Veranstaltungen. Der wichtige Punkt ist hier, dass diese Themen gestreift werden. Mehr nicht. Man hat nach dem Lesen des Buches einen Überblick darüber, was man noch lernen müsste. Viel mehr lässt sich in den, ja immer nur einige Monaten kurzen, Seminaren wohl auch nicht erreichen. In einem Buch würde es sich aber erreichen lassen, da hätte man mehr Platz. Gleichzeitig ist der Vorteil von Seminaren, dass diese immer aus dem Gezeigten, hier dem Skript, und dem persönlich durch die Dozierende Vermittelten bestehen. Im Buch fällt die Vermittlung fort, die oft das Gezeigte erst sinnfähig macht. Es wäre eigentlich zu hoffen gewesen, dass dies durch mehr und konkreteren Text ausgeglichen würde, so dass das Buch tatsächlich als Handreichung und eben nicht nur als Anregung, weiterzulernen (was selbstverständlich auch seine Berechtigung hat), zu nutzen gewesen wäre.
*
Wie gesagt, vermittelt der Titel, dass das Buch etwas anderes wäre, als es tatsächlich ist. Es sind keine Grundlagen, die vermittelt werden, sondern es ist mehrere Schritte darunter anzusiedeln, als ein Aufzeigen von zu behandelnden Themen. Vor allem ist es aber nicht, wie im Titel behauptet, für Schulbibliotheken sinnvoll. Die Veranstaltungen, die hier geschildert werden, sind solche, die ausserhalb des Schulalltags in Öffentlichen Bibliotheken durchgeführt werden können, auch in Zusammenarbeit mit der Schule (dazu gibt es einige Aussagen im Buch). Schulbibliotheken, zumindest der grösste Teil, haben aber gar nicht die Aufgabe, selber Bildungsaktivitäten zu entfalten; sondern vor allem, den Schulalltag zu unterstützen. (Die Autorin, welche früher in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein arbeitete, weiss das bestimmt selber. Nur wenn man die wenigen Schulbibliotheken, die sich als „kleine Öffentliche Bibliotheken“ verstehen, als Normalfall behauptet, ergäbe der Titel einen Sinn. Zu vermuten ist, dass der Verlag – welcher von den wenigen Monographien zu Schulbibliotheken, die aktuell auf dem Buchmarkt greifbar sind, immerhin zwei publiziert hat und damit die meisten2 – zumindest diesen Zusatz angebracht hat.) Das ist ärgerlich, weil es viel zu wenig Literatur zu Schulbibliotheken in deutscher Sprache gibt und dieses Buch eher „so tut“ als gehörte es dazu, auch wenn es Abschnitte enthält, die Schulbibliotheken thematisieren.
*
Auffällig ist zudem, dass das Buch sehr, viel zu sehr positiv geschrieben ist. Dabei ist pädagogische Praxis – egal in welchem Feld – einerseits voll von Scheitern, auf das vorbereitet werden sollte: Eigensinnige Lernende, unerwartete Lerneffekte, wo das, was man vermitteln will, bei den Lernenden ungewollte Effekte hat, Verweigerung, die zu Lernprozessen oft dazu gehört. Das ist normal, bei allen Bildungsaktivitäten, aber in diesem Buch wird der Eindruck vermittelt, das bei richtiger Planung schon alles gut laufen wird. Das scheint gefährlich. Andererseits ist das Feld „Bildung“ – egal ob Didaktik oder Bildungspolitik – voller Behauptungen und Floskeln, die oft Profanes überdecken. Es wäre sinnvoll, dies mit einem kritischeren Blick anzugehen, zum Beispiel die Aussagen des Nationalen Bildungsberichtes nicht einfach für bare Münze nehmen, wie es im Buch gemacht wird, sondern auch als politisches Dokument zu lesen. (Das wäre Kritik im Sinne von Textkritik.) Gut möglich, dass die im eigentlichen Seminar passiert, im Buch fehlt es.
*
Grundsätzlich fehlt dem Buch, auch wenn Lerntheorien kurz besprochen werden, Theorie. Vieles wird einfach behauptet, kaum erklärt, schon gar nicht in Modellen, die man überprüfen beziehungsweise weiterentwickeln könnte und die Sachverhalte erklärten (zum Beispiel nicht nur aufzählen, was es für Formen des Lernens gibt, sondern zeigen, was diese für Effekte im Lernprozess der Lernenden haben). Es ist, wie schon gesagt, sehr Hands-On. (Wilfried Sühl-Strohmenger und Ulrike Hanke haben das in ihrem Buch „Bibliotheksdidaktik: Grundlagen zur Förderung der Informationskompetenz“ expliziter versucht, Olaf Eigenbrodt arbeitet offenbar – wenn man den Verlagsankündigungen und seinen Vorträgen trauen darf – an einem Buch zu Lerntheorien, dass vielleicht diese Lücke besser schliessen wird.)
*
Aus Öffentlichen Bibliotheken tönt regelmässig der Wunsch, Handreichungen zu erhalten, wie bestimmte Dinge zu tun sind. Die zu leifern sei die Aufgabe von Expertinnen und Experten, Fachhochschulen. Das Buch reagiert gut auf diesen unmöglichen Wunsch (da diese Handreichungen niemals so genutzt zu werden scheinen, wohl weil die realen Aufgaben immer komplexer sind, als das sie in solchen Handreichungen abgedeckt werden könnten und weil sie immer nur einen Teil der Arbeit abnehmen und die Umsetzung doch Aufgabe der jeweiligen Bibliothek bleibt) indem es eine Übersicht an Themen liefert, die zu bearbeiten, vor allem selber zu lernen wären. Nicht weniger.
Fussnoten:
1 Disclaimer: Der Rezensent unterrichtete bis vor Kurzem einen ähnlichen Kurs (an der Fachhochschule Potsdam), deshalb scheint ihm die objektive Bewertung der Inhalte schwierig. Grundsätzlich, wenn auch mit anderen Schwerpunkten und etwas kritischer, wurde in seinem Kurs Ähnliches angesprochen. Die Parallelen sind allerdings erstaunlich. (Zudem wird einen seiner Arbeiten ausführlich zitiert, was es noch schwieriger macht, das Buch wirklich objektiv zu bewerten.) Deshalb hier die eher rein positivistische Darstellung.
2 Disclaimer: Eines davon vom Rezensenten mitgeschrieben, insoweit ist es auch nicht möglich, eine objektive Bewertung des Verlages vorzunehmen.
Eine kurze Geschichte zu einem bibliothekarischen Phantomschmerz
Zu: Helga Schwarz (2017). Das Deutsche Bibliotheksinstitut: Im Spannungsfeld zwischen Auftrag und politischem Interesse. Berlin: Simon verlag für Bibliothekswissen, 2017 [2018]
von Karsten Schuldt
Die Autorin des Buches, welches hier besprochen werden soll, hat aktuell relativ viele Auftritte in der Presse, da sie ihre Promotion – die in dem Buch vorgelegt wird – mit 81 Jahren abgeschlossen hat (zum Beispiel hier, hier, hier). Das ist auch beachtlich und eine symphatische Human Interest Story. Vor allem zeigt ihre Lebensgeschichte (erst Bibliothekarin, dann Programmiererin für Bibliotheken, Firmeninhaberin für Bibliothekssoftware und jetzt Doktorin der Bibliothekswissenschaft) ein ungebrochenes Interesse am Bibliothekswesen, dass zu bewundern ist.
In dieser Besprechung soll es allerdings nicht um diese Leistung, sondern vorrangig um ihr Buch gehen, dass als Übersicht eine Forschungslücke schliesst, die das Bibliothekswesen, wenn es an der eigenen Entwicklung wirklich interessiert wäre, schon längst hätte schliessen müssen (und können), aber gleichzeitig auch einige Kritik verdient.
I.
Ihr Buch umfasst die gesamte Geschichte des Deutschen Bibliotheksinstituts (dbi), einer Einrichtung, die denen, die noch nicht so lange im Bibliothekswesen sind, gerne einmal als der Glanz alter Zeiten vorgehalten wird. Früher hätte es das Institut gegeben, dann (2000) war es weg und seitdem scheint es irgendwie nicht mehr so gut zu sein im Bibliothekswesen. (Der Rezensent gehört zu denen, die nach 2000 im Bibliothekswesen ankamen und damit das dbi auch nicht mehr live erlebt, sondern nur davon gehört haben. Vielleicht hat das seine Meinung vom Buch auch geprägt.)
Dabei war die Geschichte es dbi erstaunlich kurz. Offiziell gegründet – selbstverständlich mit Vorlauf und Vorläufereinrichtungen – 1978, 2000 geschlossen und bis 2003 abgewickelt, existierte es gerade einmal 25 Jahre (drei davon in Auflösung) und hatte zum Beispiel auch nur einen Direktor und eine Direktorin. So viel Zeit hatte es also gar nicht, um Einfluss zu entwickeln.
Gegründet wurde es mit den folgenden Vorgaben:
„Das Institut erforscht, entwickelt und vermittelt bibliothekarische Methoden und Techniken mit dem Ziel der Analyse, Entwicklung, Normierung und Einführung bibliothekarischer Systeme und Verfahren.“ §2 des Gesetz über das Deutsche Bibliotheksinstitut vom 22. Mai 1978
Zeitlebens scheint es aber auch andere Ziele und Begehrlichkeiten von Bibliotheken und bibliothekarischen Verbänden gegeben zu haben. Das Buch deutet diese an, aber – dies eine Kritik, die weiter unten nochmal ausgeführt wird – es wird nicht richtig klar, welche Ziele das genau waren. Während seiner Existenz übernahm es Arbeiten an Systematiken, unterhielt Kommission (die später in den dbv übergingen, wo sie auch „herkamen“, und die Grundlage dessen heutiger Kommissionen / Fachkommission darstellten), gab Publikationen heraus (zum Beispiel die Zeitschrift schulbibliothek aktuell oder die Reihe dbi-materialien, welche aber nach Angabe des Buches oft Studien anderen Einrichtungen und nicht des dbi publizierte) und betrieb Datenbanken, zum Beispiel die Zeitschriftendatenbank und bauten (das wird mehrfach betont) subito auf (jetzt bekanntlich von einem Verein getragen). Auch nach dem Lesen des Buches wird aber über solche Aufzählungen hinaus nicht so genau klar, was das Institut tatsächlich tat oder hätte tun sollen. Gleichzeitig war es gross, zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte es über 100 Angestellte.
Nach dem Aufbau war es in den 1980er Jahren aktiv, dann geriet es in den Strudel der Veränderungen in der Wissenschafts- und Kulturpolitik nach der Wende in der DDR und der Vereinigung von BRD und DDR. Ende der 1990er wurde es dann abgewickelt.
Diese Geschichte ist das Thema des Buches. Die Autorin orientiert sich dabei auf die institutionelle Sicht. Es geht in ihrer Geschichte um Gesetze, politische Entscheidungen, Verordnungen, Evaluationsverfahren, Lobbyversuche. Dabei hat sie – wie es bei einer Promotion dieser Art zu erwarten ist – intensiv in Archiven gearbeitet und Interviews mit Beteiligten geführt. Was man aber nicht erwarten darf – obwohl es sich anböte – sind Angaben über die inhaltliche Arbeit des Instituts und seiner Wirkung (oder auch Nicht-Wirkung) auf Bibliotheken. Das wird alles nur angerissen und in Stichworten abgehandelt.1
II.
Leider hat die Autorin – entgegen ihrer Aussage im Vorwort, als Unbeteiligte einen objektiven Blick auf diese Geschichte zu haben – doch die Tendenz, ohne weitere Quellen (die vielleicht in der eingereichten Fassung der Promotion vorhanden waren und erst für den Verlagsdruck entfernt wurden) eigene Meinungen zu vertreten, teilweise sogar dem dbi, dem ehemaligen Direktor, ungenannten Angestellten des dbi oder auch den Bibliotheken und bibliothekarischen Verbänden, Vorwürfe zu machen. Dies wird insbesondere in den Fazits der einzelnen Kapitel – die ansonsten sehr hilfreich sind – deutlich.
Hinzu kommt die Tendenz, die Quellen nicht quellenkritisch zu verwenden, sondern – wenn es in die Argumentation passt – für die Wahrheit zu nehmen, teilweise auch „aufzuleveln“. So wird der Bericht von einer Konferenz, den Claudia Lux lieferte, zu einer „Studie“ erklärt, welche Claudia Lux durchgeführt hätte. Als ausländische Stimmen zur Schliessung wird mit Jean-Marie Reding gleich mehrfach ein Kollege aus Luxemburg zitiert, welcher bis heute sehr engagiert dem luxemburgischen Bibliotheksverband vorsteht, auf jeder bibliothekarischen Konferenz in Deutschland und der Schweiz vertreten ist und immer eine dezidierte Meinung hat – und mit diesem Wissen und dieser Aktivität gerade nicht irgendeine „ausländische bibliothekarische“ Stimme ist. Schwarz tut aber so, als wäre seine Meinung repräsentativ für die Reaktionen aus dem Ausland.
Sie hat eine Meinung zum dbi und versucht diese zu untermauern. Für eine Promotion oder einen objektive Geschichte ist das nicht angebracht und auch tatsächlich der grösste Kritikpunkt, der in dieser Rezension anzubringen ist. Es ist bleibt eine subjektive Darstellung, wenn sie auch ausführlich (auf institutioneller Ebene) ist und auf reichem Quellenmaterial, dass durch die Publikation ja in den Diskurs eingeführt wird und jetzt von anderen genutzt werden kann, basiert.
III.
Die Autorin setzt auch dazu an, zu erklären, wieso das dbi wieder geschlossen wurde. Es wird dazu wohl immer mehrere Deutung geben, aber laut dem Buch scheint es ein Zusammenspiel aus Animositäten innerhalb des dbi, einen schwachen Chef – wobei nicht ganz klar wird, ob die Autorin dies auch der Person selber vorwirft oder nur der Konstruktion des dbi, bei dem der Leiter keine richtige Weisungsbefugnis aber gleichzeitig mit dem Kuratorium eine übergeordnete Aufsichtsinstitution hatte – und einer Änderung der Wissenschaftspolitik, die von den Bibliotheken und bibliothekarischen Verbänden übersehen worden sei, gegeben zu haben. Das wird aber nicht nachgewiesen.
Vielmehr hat die Autorin gerade im zweiten Teil des Buches, der dem Ende des dbi gewidmet ist, die Tendenz, die Geschichte als Politikroman zu schreiben, wo einzelne Beamtinnen und Beamte der Verwaltungen, einzelne Politikerinnen und Politiker sowie Bundesländer Interessen hätten (die nicht so richtig erklärt, sondern als gegeben vorausgesetzt werden), welche dann gegeneinander intrigieren und dabei das dbi schliessen. Einen solchen Roman könnte man auch für den Anfang schreiben, aber das unterbleibt. Vielmehr hat die Autorin die Angewohnheit, im zweiten Teil ständig und ohne grösseren Kontext die Beteiligten an allen möglichen Kommissionen und Verwaltungen aufzuzählen, mit Namen und Funktion, während die Beteiligten im dbi bis auf den Direktorin und die spätere Direktorin fast immer ungenannt bleiben. (Genannt werden noch die Angestellten der Bibliothekarischen Arbeitsstelle, die aber gar nicht zum dbi gehörte, obwohl sie im Buch viel Platz eingeräumt bekommt.) Selbst dann, wenn einzelnen Personen im dbi Vorwürfe gemacht werden, bleiben sie ungenannt. Es scheint, als wäre die Politik Schuld und müsste deshalb benannt werden.
Dabei ist die Situation aus Sicht des Rezensenten recht einfach, wenn sie auch für das Personal des dbi damals persönlich destruktiv war: Das dbi wurde in der Gründungswelle von Bildungs- und Kultureinrichtungen in den 1970er Jahren gegründet und zwar in Berlin, weil Berlin – so das Buch – versuchte, sich als Zentrum des bibliothekarischen Einrichtungen zu etablieren.2 In einem politischen Akt wurde die Finanzierung für das Institut – wie für viele andere Einrichtungen dieser Gründungswelle – durch einen Eintrag auf der „Blauen Liste“ – die Einrichtungen umfasste, welche von Bund und Ländern gemeinsam gefördert wurden – gesichert. 1989 änderte sich diese Lage, einmal durch die Wende und ein anderer Mal durch die Änderung der Wissenschafts- und Kulturpolitik, die sich nun verstärkt am neoliberalen Denken orientierten. Berlin fokussierte sich darauf, Hauptstadt zu werden, die Förderung wurde von Infrastruktur auf Projektförderung umgestellt, mit der Abwicklung von Einrichtungen der DDR bildete sich eine Kultur der Abwicklungen aus, die auch auf Einrichtungen ausserhalb der DDR ausgriff.
Inhaltlicher Grund für die Schliessung des dbi war eine Evaluation durch den Wissenschaftsrat, der die Blaue Liste – jetzt die Leibniz-Gemeinschaft – zu einer Liste von Forschungseinrichtungen umbauen wollte. Die Evaluation stellte, neben anderem Lob und anderen Schwächen, fest, dass das dbi keine Forschungseinrichtung sei und empfahl die Schliessung. Die deutschen Bibliotheken scheinen dies – so zumindest die Reaktionen, von denen die Autorin berichtet – nicht so verstanden zu haben, sondern als Angriff auf die bibliothekarische Arbeit. Schwarz betont, dass sich vor allem Öffentliche Bibliotheken diese Vorstellung zu eigen gemacht hätten, während sie grossen Wissenschaftlichen Bibliotheken vorwirft, auch darauf geschaut zu haben, Projekte des dbi übernehmen zu können. Das könnte aber auch nur heissen, dass Wissenschaftliche Bibliotheken schon früher die Kultur der Projektförderung kennengelernt hatten und deshalb sahen, dass das dbi nicht weiterzuführen wäre.
Was in dieser Geschichte fehlt, scheinen zwei Dinge zu sein: Zum einen scheint es, als wäre das dbi immer nur das Ergebnis einer politischen Entscheidung gewesen, und zwar nicht vom Bund, sondern einem Bundesland, dass eine Nische zu besetzen suchte. Wenn das stimmt, wäre es nur logisch, dass – als diese Nische unnötig wurde, weil Berlin Hauptstadt war – das dbi nicht weiter gefördert wurde. Zum anderen scheint die Schliessung des dbi gerade nicht spezifisch gegen Bibliotheken gerichtet gewesen zu sein, sondern liest sich auch im Nachhinein so, als wäre sie ein später Teil der ganzen Abwicklung von Einrichtungen in den fünf neuen Bundesländern und Berlin gewesen, die in den Mitte bis Ende der 90er Jahre die Berliner Politik bestimmten, nur dass es beim dbi auch Auswirkungen auf Bibliotheken im restlichen Deutschland hatte. Aber abgewickelt wurde damals ständig irgendetwas. Man hätte diesen Kontext darstellen können, dann wäre auch diskutierbar geworden, ob und wie hier das dbi herausstach oder gerade nicht herausstach.
Dies wurde von den bibliothekarischen Verbänden und Bibliotheken, die sich äusserten, nicht so gesehen. Diese schrieben gegen die Abwicklung an und behaupteten eine besondere Wichtigkeit des dbi; eine Position, die Schwarz übernimmt, auch wenn sie den Verbänden vorwirft, damals die geänderte Zeit nicht gesehen zu haben. Aber so, wie sie es darstellt, scheinen die Veränderungen generell gegen das dbi gerichtet gewesen zu sein. Es wird im Buch ständig eine Klage wiederholt – dass eine frühere Evaluation die Fokussierung auf Öffentliche Bibliotheken gefordert hätte und dann später genau dieser Fokus negativ gewertet wurde – die wohl in den späten 1990er im Bibliothekswesen regelmässig wiederholt wurde, und angedeutet, dass diese spezifisch unfair gewesen wäre. Im grösseren Kontext scheint dies aber nur die gängige Variante der damaligen Schliessungspraxen von Einrichtungen gewesen zu sein.3
Der Rezensent würde die Situation eher dahin gehend interpretieren, dass das dbi von Anfang an schwach angebunden und mit einem unmöglichen Auftrag versehen war – oder anders: dass das Ende eigentlich schon bei der Gründung angelegt war.
IV.
Es wäre zu erwarten, dass eine Arbeit, wie sie die Autorin vorlegte, mit ihren rund 400 Seiten plus Anhängen, auch vermittelt, was das dbi eigentlich genau getan hat und wozu es – so die Behauptung aus der Bibliotheksszene am Ende des dbi – unverzichtbar gewesen sei. Das wird aber überhaupt nicht klar. Schwarz nennt zwar eine Anzahl an Arbeitsgebieten, aber das verbleibt auf einer ganz oberflächlichen Ebene.
Ein Beispiel: Die Autorin sieht die Arbeit im Anschluss an die Wende als den eigentlich Höhepunkt des dbi an, welches zahllosen Bibliotheken in der DDR, dann in den fünf neuen Bundesländern, Beratungen geboten hätte, damit diese ihre neuen Herausforderungen meistern könnten. Aber wie sah das den genau aus? Schwarz erwähnt Weiterbildungsveranstaltungen und persönliche Beratung. Nur: Welche Weiterbildung? Wie? Was waren die Themen? Was waren die Effekte? Wie sinnvoll war das wirklich? (Insbesondere während der Streichungswellen der frühen 90er Jahre.) Und was heisst persönliche Beratung? Ist da jemand durch die Lande gefahren und hat in den Bibliotheken Händchen gehalten? Software erklärt? Den Buchhandel? Gab es einen Telefon-Hotline? Darüber schweigt sich Schwarz aus, obwohl sie diese Beratung mehrfach betont. Und so steht es praktisch mit der gesamten Arbeit des dbi. Was haben all die Angestellten dort getan?Was wurde mit dem Rechner gemacht? Was war die Aufgabe der Datenbanken? (Schwarz nennt zum Beispiel regelmässig die Zeitschriftendatenbank, die Bibliothekarinnen und Bibliothekaren bekannt ist, aber anderen potentiellen Leserinnen und Lesern ihres Buches unbekannt sein dürfte.) Das ist auch nach dem Buch überhaupt nicht klar (und somit kann man auch mit dem zeitlichen Abstand zur Schliessung nichts mehr aus dieser Arbeit lernen). Es bleibt bei oberflächlichen Andeutungen.
Das gilt aber auch dann, wenn das dbi kritisiert wird (oder Kritiken zitiert werden). Gerade der Begriff „innovativ“ – im Sinne von „das dbi war nicht innovativ genug“ – wird im Buch oft angeführt, ohne das ersichtlich wird, was heissen soll. Teilweise scheint es – weil die Autorin mehrfach betont, dass das dbi gerade in den letzten Jahren seines Bestehens veraltete Hardware genutzt hätte und nicht sofort im Internet aktiv war – als hätte es mehr Software und Hardware haben und einsetzen sollen (und wohl auch Bibliotheken anbieten). Aber ist das schon „innovativ“? Ist das nicht gerade eine so verkürzte Vorstellung, dass es schon wieder zum Sujet wird? Teilweise scheint die Autorin vorauszusetzen, als wüssten alle Lesenden, was eigentlich die Aufgaben des dbi gewesen wären; aber das stimmt ja (wie schon mehrfach gesagt) nicht.
Grundsätzlich ist es berechtigt, eine Untersuchung, wie sie Schwarz unternommen hat, auf die institutionellen Vorgänge zu fokussieren. Es hätte aber dargestellt werden müssen, dass dies der Fokus; die Kritik ist hier hauptsächlich, dass genau dies unterblieb und mit dem Buch der Eindruck vermittelt, als würde eine Gesamtgeschichte des dbi versucht.
Ein Ergebnis diese oberflächlichen Darstellung ist allerdings, auch weil wir in einer Zeit leben, in der das dbi schon seit bald 15 Jahren nicht mehr existiert und das deutsche Bibliothekswesen trotzdem nicht zusammengebrochen ist (ganz abgesehen davon, dass andere Bibliothekswesen nie ein solches Institut hatten), als wären die ganzen Unterstützungsaussagen, die am Ende aus dem Bibliothekswesen für das dbi abgegeben wurden, nur das gewesen – Unterstützung in letzter Minute, ohne wirklichen Realitätsgehalt. Es wäre vielleicht nicht die Aufgabe der Autorin, aber von anderen gewesen, wirklich zu begründen, wozu das dbi nötig gewesen war (und vielleicht wieder wäre) – und nicht zu versuchen, nur die richtigen Floskeln anzubringen.
V.
Das Buch schliesst, wie schon gesagt (und wie die Autorin auch in ihren Gesprächen mit der Presse immer wieder betont), eine Lücke. Das dbi war einen Einrichtung des Bibliothekswesens, die zumindest im Nachhinein als wichtig verstanden wurde. Es ist richtig, dass diese Geschichte jetzt zumindest grundsätzlich dargestellt ist und die grundsätzlichen Quellenbestände für eine weitere Geschichtsschreibung aufgearbeitet und benannt wurden. Dass sich das Buch durch seinen Fokus auf die institutionelle Geschichte stellenweise eher träge liest, ist ihm nicht vorzuwerfen. Die Aufgabe einen Promotion ist es nicht zu unterhalten, sondern eine wissenschaftlich solide Arbeit vorzulegen.
Kritisch anzumerken bleibt die Tendenz der Autorin, ständig eigene Einschätzungen anzubringen, insbesondere, wenn diese auf Quellen aufzubauen scheinen, die nicht genannt sind. Wer hofft, durch die Aufarbeitung dieser Geschichte Argumente für ein neues dbi zu finden, wird aber enttäuscht sein. Es nicht nur nicht klar, welche Arbeit das dbi geleistet hat oder heute leisten könnte. Es wird auch klar, dass schon die Einrichtung und dann auch die Abwicklung eigentlich nichts mit den Interessen von Bibliotheken und bibliothekarischen Verbänden zu tun hatten, sondern mit politischen Entscheidung in spezifischen politischen Situationen. Mit der Verstärkung des Föderalismus in Deutschland, spätestens mit der Föderalismusreform 2006, und der Etablierung eines neoliberalen Verständnisses von Wissenschafts- und Kulturförderung, ist es unwahrscheinlich geworden, dass eine solche politische Situation in näherer Zukunft wieder eintreten wird. Und selbst dann sollte die Geschichte des dbi – aber auch anderer Projekte – eher eine Warnung davor sein, für den Aufbau bibliothekarischer Infrastrukturen auf solche politischen Möglichkeiten zu setzen – diese Situationen sind irgendwann vorbei und damit auch die Unterstützung für solche Infrastrukturen. (Bei Bauten ist das anders, die sind dann faktisch da, auch wenn die politische Situation sich ändert.)
Zu bemerken ist, dass nicht nur die Geschichte des dbi weiterhin viele blinden Flecken hat, sondern das andere Einrichtungen, die das Bibliothekswesen prägen, ähnliche institutionelle Geschichten verdienen würden, weil so klar würde, wie sie überhaupt in ihre jetzige Position geraten sind. Zu denken wäre an die grossen Firmen im Bibliotheksbereich (zum Beispiel die ekz), die bibliothekarischen Verbände, die wenigen Verlage, in denen bibliothekarische und bibliothekswissenschafliche Literatur erscheint und vor allem die schon länger laufenden Zeitschriften des Bibliothekswesens. Helga Schwarz hat anhand des dbi gezeigt, dass solche Geschichten möglich sind.
Fussnoten
1 Und genau hier scheint es einen Unterschied zwischen denen zu geben, die das dbi in den 1980ern noch in voller Arbeit erlebt haben und denen, die erst später dazu kamen. Vielleicht musste man Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in den 1980er Jahren – zumindest in der BRD und West-Berlin – nicht erklären, was das dbi macht. Vielleicht hatten alle eine Meinung dazu. Heute wäre gerade das interessant.
2 In der Argumentation des Buches ist diese Behauptung auch eine Schwachstelle, da nicht gezeigt wird, wie Berlin dieser Ziel sonst noch verfolgt hat. Das Institut für Bibliothekswissenschaft an der Freien Universität wird gar nicht erwähnt, auch andere Einrichtungen nicht. So scheint es, als wäre dieses „Interesse“ Berlins mit der Gründung des dbi schon wieder erloschen zu sein.
3 Eventuell ist das auch die persönliche Geschichte des Rezensenten, der in der gleichen Zeit, als das dbi geschlossen wurde, in der Berliner Kinder- und Jugendpolitik erlebt hat, wie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nur deshalb geschlossen wurde, weil von einem Jahr zum anderen 50% der Fördersumme gestrichen wurden, ohne weitere Begründung. Und das einige Jahre lang, zumeist mit viel kürzerer Frist zwischen Mitteilung der Streichung und der tatsächlichen Schliessung (zumeist, ohne das das Personal, wie es beim dbi passierte, in den Stellenüberhang des Landes Berlin übernommen wurde). Mit diesem Hintergrund scheint die Schliessung des dbi, die sich immerhin fünf Jahre hinzog, bei aller persönlichen Tragik für die Betroffenen, dann wieder wie ein Luxus.
Eine Fleissarbeit zur Geschichte der Öffentlichen Bibliotheken in Québec
von Karsten Schuldt
Zu: Séguin, François: D’obscurantisme et de lumières. La bibliothèque publique au Québec des origines au 21e siècle. (Histoire et politique. Cahiers du Québec) Montréal: Edition Hurtubise, 2016
Das hier besprochene Buch sieht nach einem arbeitsreichen Kraftakt aus: Auf etwas weniger als 600 Seiten (plus Anhänge) wird die Geschichte der Öffentlichen Bibliotheken in Québec, Kanada, dargestellt. Diese Geschichte, beginnend im frühen 17. Jahrhundert, geht eigentlich nur bis in die 1990er und nicht, wie im Titel angekündigt ins 21. Jahrhundert. Aber auch das alleine war gewiss eine immense Fleissarbeit, die in den zahllosen Zitaten und Angaben aus den entlegensten Quellen, die im Buch angeführt sind, sichtbar wird. Dennoch ist am Buch einiges an grundsätzlicher Kritik zu leisten. Am Ende ist es Bibliotheksgeschichte, wie sie besser nicht mehr sein sollte.
Eine impressive Sammlung
Zuvor zu den positiven Seiten. Das Buch ist umfangreich, ohne jede Frage. Es geht grundsätzlich chronologisch vor und bindet die Geschichte der Öffentlichen Bibliothek eng an die Geschichte der Kolonie und späteren Provinz Québec (anfänglich Nouvelle-France), auch wenn diese allgemeinere Geschichte nur dann angesprochen wird, wenn es unbedingt notwendig scheint. Ansonsten wird sie vorausgesetzt.
Das Buch schreibt die Geschichte anhand unterschiedlicher Bibliothekstypen, beginnend mit frühen Privatbibliotheken, Subskriptions-Bibliotheken (bibliothèques publiques de souscription) und kommerziellen Leihbibliotheken, Lesesälen etc. (bibliothèques commerciales de prêt, cabines de lecture) über Bibliotheken von Ausbildungseinrichtungen (mit und ohne politischen Anspruch), Public libraries nach US-amerikanischem Vorbild (erst als private Gründungen, dann die Übernahme durch Gemeinden) und aktuellere Entwicklungen hin zu Öffentlichen Bibliotheken als allgemein zugängliche, öffentliche getragene Einrichtungen. Die Masse des versammelten Materials und auch der Publikationsort in den „Cahiers du Quèbec“ vermitteln den Eindruck, dass hier die definitive Sammlung und Interpretation dieser Geschichte vorgelegt würde.
Dass ist alles beeindruckend, insbesondere in seinem Detailreichtum und der tiefen Gliederung. Der Autor – in der Bibliothekswissenschaft in Forschung, Lehre und Praxis in Québec tätig – kennt seine Materie. In dem gesamten Material finden sich, selbstverständlich, zahllose Bonmots und interessanten Anmerkungen.
Nicht zuletzt – das als persönliche Nebenbemerkung –, ist das Buch als kanadisches in einem erfreulich eingängigem Französisch geschrieben, weniger umwunden und poetisierend, als es in den Texten aus Frankreich oft der Fall ist.
Kritik: Eine teleologische Geschichtsschreibung der White Settler Society
Geschichtsschreibung ist immer auch die Anordnung von Ereignissen, Daten etc. und die Auswahl davon, was dargestellt und aufgezeigt beziehungsweise gerade nicht dargestellt werden soll. Gute Geschichtsschreibung zählt dabei nicht nur Ereignisse auf, sondern bietet Struktur und zeigt gleichzeitig, wie und wo sich Geschichte auch anders hätte entwickeln können. Die Offenheit der Geschichte bleibt in ihr bestehen; es wird auch vermittelt, dass Menschen in der Lage sind, Geschichte zu bestimmen und zu machen.
Eine „vorherbestimmte“ Entwicklung
Schlechte Geschichtsschreibung tut dies nicht, sie kann an vielen Punkten scheitern. Séguin scheitert daran, die Geschichte der Bibliothek in Québec als immer offene Entwicklung zu zeigen. Vielmehr geht er offensichtlich davon, dass die Öffentliche Bibliothek als allgemein zugängliche, von den Gemeinden getragene Einrichtung in der Ausprägung, wie sie heute in Québec zu finden sind, quasi das Ziel aller Entwicklung im Bibliotheksbereich sei, seit Anbeginn seiner Geschichte. Dieses Ziel sei quasi schon immer (seit dem 17. Jahrhundert) im Kern angelegt gewesen und hätte sich mit der Zeit einfach immer mehr konkretisiert. Alle vorhergehenden Formen von Bibliotheken, alle Diskussionen, alle Projekte, seien nur Vorformen, die sich quasi immer mehr zur heutigen Bibliothek entwickeln mussten, also zum Beispiel immer offener wurden. So ist das Buch strukturiert, so sind die Beispiele ausgesucht und dargestellt, so sind sie angeordnet. Es ist, um das Fremdwort zu benutzten, eine teleologische, also auf ein Ziel hin ausgerichtete, Geschichte.
Das ist, kurz gesagt, keine gute Geschichtsschreibung. Sie negiert den Gehalt älterer Diskussionen und Entwicklungen. Sie tut so, als hätte die Protagonistinnen und Protagonisten eigentlich – unbewusst – gar keine andere Wahl gehabt, als auf dieses eine Ziel (die heutige Öffentliche Bibliothek) hinzuarbeiten. So, als wenn Menschen eben doch keine richtigen Entscheidungen treffen, sondern nur dem Weltgeist folgen könnten. Deshalb übergeht das Buch auch sehr viele Fragen.
Ein Beispiel nur: Die kommerziellen Leihbibliotheken (also Unternehmen, bei denen man für eine Gebühr pro Jahr, Monat oder Ausleihe Bücher ausleihen konnte, und die – als Unternehmen – selbstverständlich auch kommerzielle Interessen verfolgten), die es sehr früh gab, die aber auch wieder eingingen, waren viel offener als spätere Bibliotheken: Wer zahlte konnte ausleihen. Punkt. Sicherlich konnte nicht jede und jeder zahlen, aber wie Alberto Martino (1990) für den deutschsprachigen Raum zeigte, waren sie für die Verbreitung des Lesens als normale Aktivität durchschnittlicher Menschen extrem wichtig. Warum also wird diese Bibliotheksform zwar erwähnt, aber im Gegensatz zu späteren Bibliotheksformen, die ihre Leserinnen und Leser mehr reglementierten und Bildungsabsichten hatten, nur als ganz frühe Vorgänger geltend gemacht? Sie existierten lange, haben also gewiss Wirkungen gehabt und präsentieren auch eine andere Möglichkeit an Entwicklung, die dass Bibliothekswesen hätte nehmen können. Aber sie passen nicht in die grosse Erzählung (die Öffentliche Bibliothek muss sich dieser Erzählung nach zur Bildungseinrichtung entwickeln), die Séguin angelegt hat.
Eine Geschichte der „grossen Männer“
Eine solche Erzählung macht es aber schwierig, die Gründe für bestimmte Entscheidungen nachzuvollziehen, die Menschen vorbrachten. Menschen tauchen bei Séguin auch – ganz in Form einer Geschichtsschreibung, von der man eigentlich dachte, sie sei untergegangen – nur als „grosse Männer“ auf, die aus der Masse herausragen und „Geschichte machen“, während andere nur folgen. Aus deren Briefen und Artikeln wird dann auch ausgiebig zitiert, aber nur aus diesen. Der Autor stellt die Entwicklung der Bibliotheken in Québec fast nur als Ideen da, die diese „grossen Männer“ hatten. Seine Geschichte ist erstaunlich kontextlos. Die Entwicklungen der Bibliotheken werden nur dann in den Kontext der Geschichte Québecs eingeordnet, wenn es unumgänglich ist. Sie waren Teil der Auseinandersetzungen um die französische und englische Sprache, zu Beginn auch zwischen Kolonialmacht und die Neu-Kolonisierten (die französisch-sprachigen) sowie der damit „verbundenen“ Kulturen, insbesondere den Ultramontanismus (die Frage, ob und wie sehr katholisch Gläubige „Papsttreu“ seien und / oder sein dürften) und den Autonomie-Bestrebungen Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts. Das wird erwähnt. Anderes wird nur vorausgesetzt. Zudem wird die Entwicklung der Bibliotheken in Québec nicht in den Kontext der bibliothekarischen Entwicklungen anderswo gesetzt, so dass es am Ende aussieht, als hätte sie sich (fast) frei von anderen Einflüssen verändert. Nur dann, wenn es nicht zu vermeiden ist (vor allem, wenn die „grossen Männer“ in ihren Texten sich explizit auf andere Beispiele – vor allem die Public Library in den USA Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts – bezogen), werden auch diese kurz erwähnt.
White Settler Society
Neben dieser, eigentlich für heutige Geschichtsschreibungen unglaublichen, Einengung fällt auch auf, dass es eigentlich nur die Geschichte der – wie ich es als kritischen Begriff aus Literatur zu Two Spirits und First Nations kenne (u.a. Driskill et al. 2011) – „White Settler Society“ erzählt wird. Séguin schildert, wenn auch wie gesagt nur kurz, Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen, die irgendwie mit Bibliotheken zu tun haben. Aber das immer mit dem Verständnis, dass es eigentlich nur zwei Gruppen gibt – mit den Sprachen französisch und englisch –, dass es halt am Anfang schon eine Kolonie gibt und die Frage nur ist, wem die „gehört“ und wie sie Provinz wird. Würde man nur Séguin lesen, man wüsste nicht, dass es in Québec First Nations gibt – die nicht nur „vorher da waren“, sondern weiterhin da sind und die zum Beispiel lange Zeit vom kanadischen Staat „integriert“ werden sollten, was hiess quasi als Gruppen verschwinden sollten, was wiederum mittels Bildung versucht wurde (Stichwort: Canadian Indian residential school system), wo zu vermuten wäre, dass Bibliotheken eine Rolle spielten – und das es andere Gruppen gibt – im Einwanderungsland Kanada, auch wenn es zeitweise nur für die Zuwanderung aus bestimmten Staaten, offen war –, die sich nicht in die Binarität französisch/englisch oder katholisch/evangelisch einteilen lassen. All das scheint für den Autor und seine Bibliotheksgeschichte nicht relevant zu sein, nicht mal – ausser ich habe es überlesen – als Anmerkung, dass es dazu nichts zu sagen gäbe. (Was so nicht sein wird.) Es ist ein unsinnig enger Blick, welcher – mal von anderen Fragen abgesehen – der Geschichte nicht gerecht werden kann. Für eine 2016 erschienenes Buch ist das ganz erstaunlich.

Ein (unbesprochenes) Detail, dass man im Buch findet, sind immer wieder Angaben zu Öffnungszeiten von Bibliotheken im 19. Jahrhundert, oft acht, neun Stunden pro Tag, fünf bis sieben Tage die Woche. Das scheint sich nicht als Tradition durchgesetzt zu haben: Hier die Öffnungszeiten der Bibliothek in Saint Édouard de Fabre, Québec (Sommer 2016). Aber auch das diskutiert Sèguin nicht, er nennt einfach nur die Öffnungszeiten älterer Bibliotheken, wenn er sie irgendwie findet.
Zuviel und zu wenig
Trotz dieser Kritik hat das Buch fast 600 Seiten, insoweit wäre es vielleicht möglich zu argumentieren, dass es nicht noch länger hätte werden sollen. Aber leider sind diese 600 Seiten durch zahllose Details erreicht worden, die wenig für das konkrete Thema liefern. Teilweise scheint es, als hätte der Autor – der offenbar auf eine über längere Zeit angesammelte, grosse Materialbasis zurückgreift – einfach alles, was er irgendwo zum Thema gefunden hat, darstellen wollen. Das macht das Buch über Längen recht langweilig, wenn zum Beispiel die Kataloge früher Bibliotheken ausgezählt und die unterschiedlichen Bestandsgruppen verglichen werden. Details, die zum einer Aussage hingeführt hätten werden müssen (Was sagt uns diese Verteilung?), aber so nur Seiten füllen. Ganz besonders auffällig ist das bei der idée fixe des Autors, ohne jeder weitere Einordnung Geldsummen zu nennen. Aber was nützt es zu wissen, dass die Mitgliedschaft in der und der Subskriptions-Bibliothek so und so viele Schilling oder Dollar gekostet hat, wenn man nicht weiss, wie das Preisniveau sonst war und mit welcher Summe das heute zu vergleichen wäre?
All diese Details machen das Buch dick und nötigen auch einen grossen Respekt vor der Arbeit, die im Buch steckt, ab. Am Ende kann so eine Sammlung aber nur Ausgangspunkt für detaillierte Studien sein, die das nötige Mehr (die Offenheit der Geschichte darstellen; zeigen, wie und wo sie sich hätte anders entwickeln können; die Geschichte nicht als reine Geschichte der White Settler Society schreiben, sondern als Geschichte diverser Gruppen, die mehr oder weniger Macht hatten; als Geschichte der vielen Menschen und nicht der paar „grossen Männer“ und so weiter) beitragen müssten.
Literatur
Driskill, Qwo-Li; Finley, Chris; Gilley, Brian Joseph; Morgensen, Scott Lauria (edit). (2011). Queer Indigenous Studies: Critical Interventions in Theory, Politics, and Literature. Tucson: The University of Arizona Press, 2011
Martino, Alberto (1990). Die deutsche Leihbibliothek: Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914). (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 29). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1990
Séguin, François: D’obscurantisme et de lumières. La bibliothèque publique au Québec des origines au 21e siècle. (Histoire et politique. Cahiers du Québec) Montréal: Edition Hurtubise, 2016
Die Klassifikation ist ein Machtverhältnis
Zu: Adler, Melissa (2017). Cruising the Library: Perversities in the Organization of Knowledge. New York: Fordham University Press, 2017
von Karsten Schuldt
Although we might imagine the library as a kind of Utopia – an island, in a sense, that houses a great bounty of literature and knowledge to which access is granted to all members of society, the idea of a library as a perfect plan crumbles when we understand how access by subject is organized. (Adler 2017:XII)
I
Cruising the Library ist eine buchlange Reflexion über die Macht, die durch bibliothekarische Klassifikationen ausgeübt wird, diskutiert anhand des Beispiels der Library of Congress (LoC). Melissa Adler – selber Assistant Professor für Library and Information Science – nutzt dazu, wenig überraschend, feministische, post-strukturalistische und anti-rassistische Theorie, insbesondere Eve Kosofsky Sedgwick, Michel Foucault und Roderick A. Ferguson. All diese theoretischen Ansätze thematisieren in der einen oder anderen Weise die Gewalt und Einschränkungen, die Wissenssysteme produzieren, und versuchen gleichzeitig zu verstehen, wie man diesen entkommen oder gerade doch nicht entkommen kann.
Die Klassifikation der LoC wird von Adler als ein solches Wissenssystem par excellence verstanden, dass gleichzeitig durch die Aufstellung von Bücher die eigene Struktur sichtbar macht. Ein Beispiel, gleich vom Beginn des Buches, ist die Beobachtung, dass Medien zu Bi- und Homosexualität (HQ74-74.2, HQ75-76.8) neben solchen zu „Sexual Deviations“ (HQ71-72) – was heute vor allem Verbrechen wie Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch heisst, aber früher auch verpönte Sexualpraktiken wie Cunnilingus und Fellation beinhaltete – aufgestellt werden, obwohl dies inhaltlich nichts miteinander zu tun; aber im Denken früherer Zeiten schon. Und dies, da diese Klassifikation in zahllosen Bibliotheken als Aufstellungssystematik genutzt wird, auch tatsächlich so in räumlich in Regalen von Bibliothek umgesetzt wird. Hat das Auswirkungen, zum Beispiel darauf, wie Bi- und Homosexualität wahrgenommen wird oder welche Verbindungen gedanklich hergestellt werden? Adler bejaht dies. Neben diesen Verbindungen, die die Klassifikation impliziert, grenze die Klassifikation andere Themen und Diskussionen ab, stellt also andere Verbindungen gerade nicht her.
II
Ein Argument Adlers ist, dass die Klassifikation und gleichzeitig die USA als Staat entstanden, als im 19. Jahrhundert ein sehr spezifisches Wissenssystem vorherrschte, in welchem davon ausgegangen wurde, dass Wissen einmal und dann richtig zu erfassen und zu ordnen sei; dass also auch eine Systematik in der Lage sei, dass gesamte Wissen der Welt abzubilden. Dieses Denken war beherrscht vom Wunsch nach klaren Abgrenzungen, hierarchischen Ordnungen und gleichzeitig getragen von der Überzeugung, dass das Wissen nur so und nicht anders zu ordnen sei. Zu leisten war deshalb die Arbeit, die richtigen Abgrenzungen zu definieren. Nicht zufällig wurde in dieser Zeit auch neues Wissen – im Sinne von Wissen, dass Handlungen anleitete – produziert über die Geschlechtsidentitäten und Geschlechterverhältnisse (mit klarer Dichotomie), Sexualität (mit Abgrenzung von „richtigem“ und „falschem“ Sex, was – wie Foucault bemerkte – zu einem ständigen Diskurs über all die „Perversitäten“ führte, die eigentlich ausgegrenzt werden sollten) und dem modernen Rassismus (der die Einteilung von Menschen als wissenschaftlich und selbsterklärend verstand). Oder anders: Eine Zeit, die in ihre System Ordnung einschrieben, die gar nicht vorsahen, dass andere Ordnungen möglich seien. Die Klassifikation der LoC gilt Adler als – an sich sichtbare, historisch nachvollziehbare – Ordnung, die grundsätzlich weiter so funktioniert, auch wenn sie sich mit der Zeit verändert hat. (Dies auch im Gegensatz zu den geheim gehaltenen Wissensordnungen von Suchmaschinen oder Firmen, die mit Big Data arbeiten.)
Sie zeigt die Absurditäten, die eine solche Ordnung hervorbringt, mehrfach auf, zum Beispiel indem sie darstellt, wie weit das Werk von Sedgwick in der LoC verteilt wurde, obwohl Sedgwick gerade über die Verbindung vorgeblich unverbundener Themen schrieb. An anderen Beispielen zeigt sie auch die Gewalt auf, die durch Klassifikation stattfindet, beispielsweise wenn Bücher, die sich explizit gegen die Verwendung bestimmter Begriffe (oder Denkmuster) wenden, in der Klassifikation fast folgerichtig gemassregelt und genau unter diesen Begriffen eingeordnet werden. Nicht zuletzt zeigt sie, das „Normalität“ weiterhin in den LoC-Klassifikation eingeschrieben ist, wenn es in weiten Strecken nur für „abweichende Gruppen“ gesonderte Stellen in der Klassifikation gibt, aber nicht für den „Normalfall“ (was zumeist heisst Weiss und / oder heterosexuell und / oder cis).
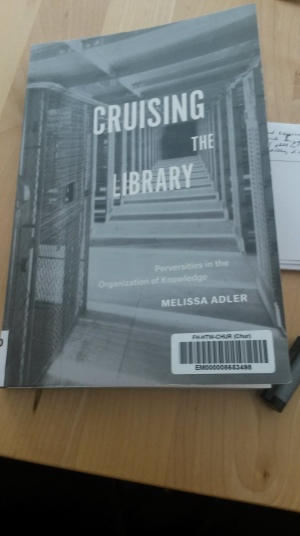
Das besprochene Buch in einem Sehnsuchtsort, dessen Existenz und Funktionieren auch nur auf der Basis von sozialen Ordnungen und absurden Begierden zu erklären ist: Einem Wiener Caféhaus.
III
Die Autorin untersucht und beschreibt diese Ordnungen und die Machtbeziehungen, die sich durch diese ausdrücken, immer wieder mit Verweisen auf die oben genannten Theorien. Gleichzeitig schlägt sie andere Formen des Navigierens durch die Klassifikation und Sammlung der LoC vor, die sie – im Anschluss an Sedgwick – als „perverse reading“ beschreibt: ein suchendes, Ordnungen missachtendes und gleichzeitig immer wieder neue Ordnungen – indem Sammlungen und Verbindungen, und wenn gedanklich, hergestellt werden – generierendes Suchen und Sich-treiben-lassen. Die Verweise auf Sexualität (perverse reading, Treiben-lassen als dem Folgen von Begierden und unbewussten Wünschen, der Titel des Buches „“Crusing in the Library“, der auf das Crusing als Teil der schwulen Kultur verweist und so weiter) sind nicht zufällig. Vielmehr ist es der Anschluss an Foucault, der – wie oben gesagt – festhielt, dass das ständige Abgrenzen der „richtigen Sexualität“ gerade im 19. Jahrhundert, in dem angeblich so wenig über Sexualität gesprochen worden sei, gerade doch ein ständiges Reden über diese hervorbrachte. So, wie sich im 19. Jahrhundert ständig Gedanken über alle möglichen Formen von „Perversität“ gemacht wurde und sie überall gesehen wurden, ermöglicht nach Adler gerade das Suchen nach „Perversitäten“ im Bestand das Aufzeigen der Grenzen von Klassifikationen:
Perhaps unsurprisingly, where we locate ‚perverse‘ subject, we find that that the classification fails to capture them., The concept of perversion pushes these systems to their limits, dismantling and opening them up to more just ways of organizing and finding knowledge in the library. By problematizing the systems and exposing their failings, the hope is that we find possibilities for creating new ways of facilitating queer and perverse readings. (Adler 2017:3)
Und das tut sie, in gewisser Weise, das gesamte Buch über (beschränkt auf die gedruckten Bestände). Sie postuliert, dass es notwendig sei, sich der Suchrichtung durch das System auf eine/n „User“ – der oder die dazu erzogen würde, genau das zu wollen, was das System bietet – zu verweigern, um zu einer besseren Klassifikation zu gelangen; besser nicht im Sinne von genauer, sondern von offener und verantwortungsvoller gegenüber der Realitäten.
In einem gesonderten Kapitel zeigt Adler anhand der Geschichte der „Delta-Collection“, die irgendwann zwischen 1880 und 1920 angelegt und bis 1964 geführt wurde und all die Werke verschliessen, quasi unsichtbar machen sollte, die als pervers galten, dass die Bibliothek eben nicht, wie sie gerne behauptet, eine „neutrale Einrichtung“ ist. Sie war eine Einrichtung, die einerseits eine aufklärerische Funktion haben wollte, doch gerade beim Thema Sexualität (aber nicht nur, ein weiteres Kapitel beschreibt den inhärenten Rassismus der Klassifikation) versuchte, aktiv Medien zu verstecken. Das erinnert, wieder nicht zufällig, an Freud aber auch an die Analyse der Aufklärung und ihrer Mythen durch Adorno und Horkheimer.
Und trotz all dieser Kritik hat Adler ein positives Verhältnis zur Bibliothek, ein Erstaunen vor all der Arbeit, die in das Ordnen des Wissens gesteckt wurde und vor der Widerstandsfähigkeit der Klassifikation. Sie nennt es – zum Grundton des Buches passend – ein sadomasochistisches Verhältnis, führt am Schluss Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ ein, um dieses zu beschreiben.
IV
Das Thema des Buches ist nicht neu, viele Beobachtungen scheinen schon anderswo beschreiben worden zu sein. Allerdings nicht unbedingt in Buchlänge. Positiv ist der Versuch, die Wirkung der Klassifikation und der Arbeit mit ihr nicht einfach zu skandalisieren oder in Ehrfurcht vor ihr zu erstarren, sondern sie mit Hilfe verschiedener theoretischer Zugänge zu beschreiben. Teilweise kehrt die Autorin auf die immer wieder gleichen Feststellungen zurück, aber es ist immer wieder nachvollziehbar, wieso. Der Zugang über „Perversitäten“ scheint vielleicht gewollt, ist es aber nicht, wenn man der Grundthese folgt, dass die LoC und ihre Ordnung eng mit der Staatswerdung der USA und der Moderne mit ihren spezifischen Geschlechterverhältnissen, Angst vor falscher Sexualität und modernem Rassismus verbunden sind. Unter dieser Vorannahme ist die Nutzung der oben genannten theoretischen Zugänge nur sinnvoll und von diesen ausgehend die Beschäftigung mit den in der Moderne wuchernden Diskursen über Grenzen und „perversen Überschreitungen“.
Das Buch ist auch ein Versuch, klarzustellen, wieso die Tätigkeit der Katalogisierung – also die konkrete Arbeit der Bibliothek – nicht als neutral oder wertfrei verstanden werden kann, sondern nur als eine von moralischem und politischem Gewicht. Es ist ein Machtverhältnis, bei denen die Bibliothek einen erstaunlich starken Einfluss darauf hat, was wie wahrgenommen und in ein Verhältnis gesetzt wird. (Ein Einfluss, dem man nur entkommen kann, wenn man sich explizit den Regeln der Klassifikation zu entziehen versucht.)
Zu erwarten wären aber zwei Themen, die nicht angegangen werden. Zum einen wäre zu diskutieren, ob nicht RDA mit seinen Beziehungen und der grösseren Verantwortung der Katalogisierenden das Potential hätte, zumindest einige der Probleme, die Adler aufzeigt, anzugehen. Zum anderen wäre es sinnvoll gewesen, nach anderen Formen der Klassifikation zu fragen, die möglich wären, um – wie die LoC-Klassifikation – Wissen zu ordnen und damit auch zugänglich zu machen, aber gleichzeitig nicht die starren – oder zumindest nicht diese – Abgrenzungen voraussetzte. Zu denken wäre an die Brian Deer Classification, aber auch an utopische Entwürfe.
V
Letztlich aber ist das Buch, in Zeiten, in welchen die bibliothekarische Literatur so oft ohne jede Form wissenschaftlicher Theoriebildung aber auch oft ohne Leidenschaft und Trieb auszukommen scheint, ein Lichtblick. Es ist ein Buch zum Mitdenken. Nötig ist der Wunsch, verstehen zu wollen, wie Wissensordnung funktioniert, ohne gleich nach einer praktischen Anwendung zu fragen. Es ist – hier ist beim Thema des Buches zu bleiben – zuvörderst eine Arbeit, die mit einem perversen – diesmal: nicht sofort produktiven – Verlangen gelesen werden muss. So, wie Sexualität, die nicht gleich oder nur auf Fortpflanzung zielt, sondern auf Begierde und unbewusste Wünsche. Pleasure reading für Theorie- und Bibliotheksinteressierte.
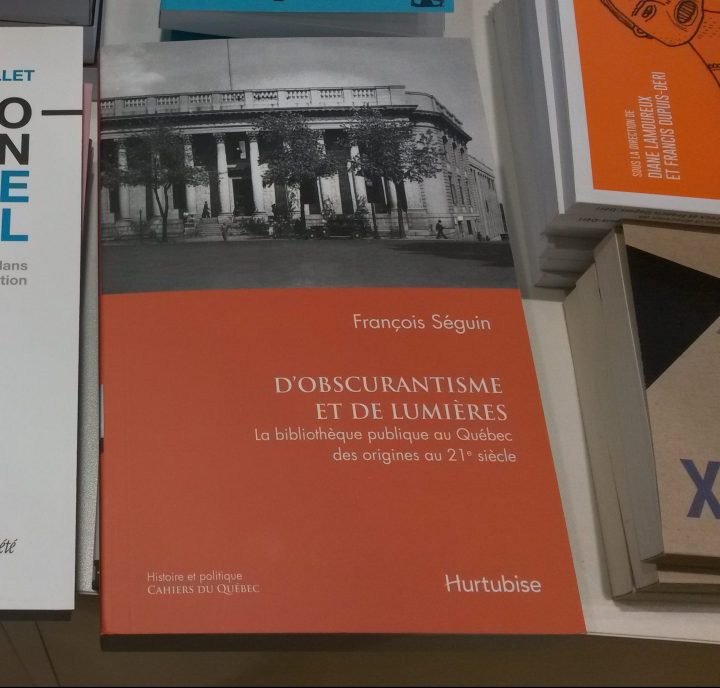
1 comment