LIBREAS #44 zum Thema „Grassroots Open Access“ ist erschienen.
Als Punktlandung zum Jahresabschluss 2023 erschien die Ausgabe 44 von LIBREAS. Das Thema ist diesmal Grassroots Open Access, was uns naturgemäß außerordentlich nahesteht, das LIBREAS bekanntlich selbst ein Graswurzel-Projekt. Zu den Hintergründen empfehlen wir den Rückblick unser erstes Editorial aus dem Jahr 2005. Dieses fasst sehr treffend das Gründungs-Mindset zusammen. Eine gewisse Naivität gehörte dazu. Was das Editorial nicht verrät, sind die Mühen und die notwendige Dreistigkeit, sowie vermutlich auch der glückliche bibliothekswissenschaftshistorische Moment, die es brauchte, um so ein Projekt aus einer Studierenden-Position überhaupt anzuschieben.
Grassroots-Open-Access heißt auch Ausdauer, Durchsetzungsstärke und, wie sich über die Jahre zeigte, eine durchaus erhebliche Frustrationstoleranz. Selbst bei einem minimalen organisatorischen Überbau, wie wir ihn bewusst wählten, gibt es immer wieder auch bürokratische und organisatorische Herausforderungen, die einerseits an der Lebenszeit und andererseits auch an der Zeit, die für die Inhalte bleibt, nagen.
Zudem ist Grassroots-Open-Access eine Sache, wenn man es mit der überschießenden Energie Studierender in ihren 20ern angeht. Es ist eine andere, wenn man es zugleich deutlich gesetzter und geforderter zwischen Vollzeitstelle und Familienmanagement betreibt. Das soll hier nur erwähnt werden, weil diese Spannung mitunter etwas im Hintergrund bleibt.
LIBREAS zeigt auch, dass Grassroots-Open-Access nicht unbedingt wissenschaftsgeleitetes Open Access im engeren Sinn sein muss. Jedenfalls wenn man wissenschaftsgeleitet als aus einer institutionellen Grundierung heraus versteht. Denn wie das Schicksal der Berufsbiografien so spielt, sind die meisten Menschen hinter LIBREAS zwar in wissenschaftlichen Infrastrukturzusammenhängen aber nicht in einem klassischen formalen Forschungskontext gelandet.
Das heißt nicht, dass wir nicht mehr wissenschaftlich arbeiten. Aber wir tun dies nicht aus den institutionell stabilisierten akademischen Strukturen, die, wie Good-Practice-Beispiele zeigen, eine sehr wichtige Voraussetzung für erfolgreiches scholar-led Open Access darstellen. LIBREAS findet traditionell noch auf einer anderen Wiese statt.
Das zeigt sich nicht nur in liebevoll von Karsten Schuldt eingefangen Cover-Impressionen. Sondern auch in dem sehr diversen Set an Beiträgen, wie es auch diese Ausgabe kennzeichnet. Eine etwas ausführliche Einordnung findet sich im Editorial zu LIBREAS #44.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns lesen. Zu Grassroots-Open-Access gehört aus unserer Sicht allerdings auch, dass wir offen für Beiträge sind. Und zwar auch für solche, die nicht unbedingt die Form eines wissenschaftlichen oder Fachaufsatzes haben. Unser aktueller Call for Papers zum Thema „Sound of Libraries“ ist dahingehend ausdrücklich als Einladung verstehen.
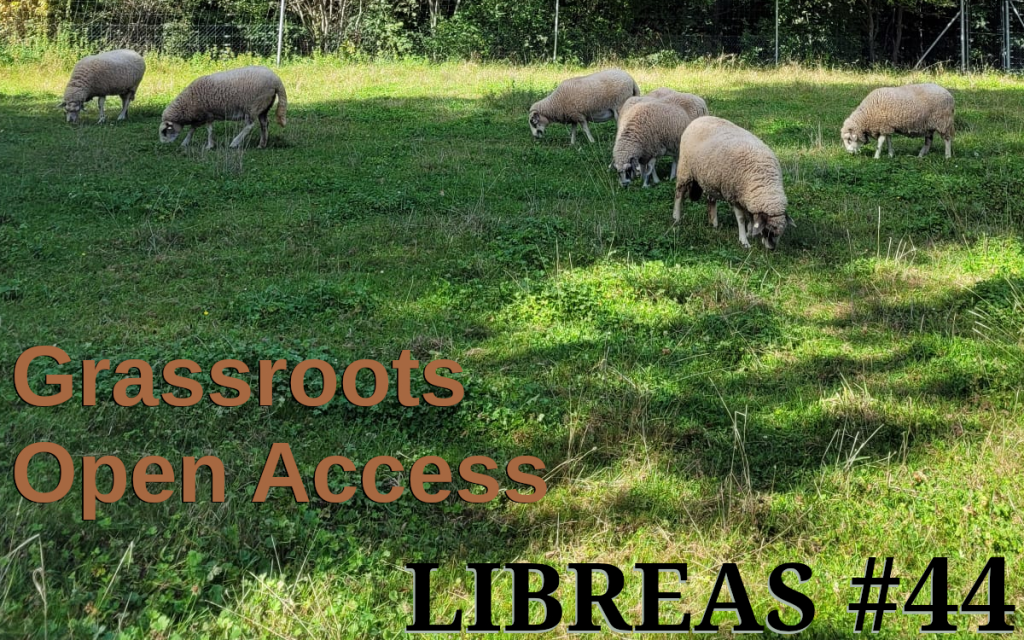
Redaktion LIBREAS — Editorial LIBREAS #44 (2023): Grassroots Open Access
Schwerpunkt
Stefan Milius & Wolfgang Thomas — Logical Methods in Computer Science — Erfahrungsbericht über die Gründung einer internationalen Open-Access-Zeitschrift
Christian Erlinger & Jens Bemme — Kamptaler Sakrallandschaften im Wikiversum
Tobias Steiner — Alte Traditionen
: zur Rolle von scholar-led publishing und Open Access in den Geistes- und Sozialwissenschaften
Philipp Falkenburg — Praxisbericht institutionalisiertes Grassroots Open Access : Beitrag der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) zum Open Access Tracking Project (OATP)
Enrique Corredera & Valérie Andres — Back to Green. Das Projekt GOAL und das Potenzial von Grün Open Access
Beiträge
Karsten Schuldt — Völkisches Büchereiwesen: Zur Geschichte der Grenzbüchereiarbeit in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus
Ben Kaden & Linda Freyberg — Makerspaces und Library Labs in wissenschaftlichen Bibliotheken — zwischen physischem Raum und forschungsorientierter Ausrichtung
Vereinsarbeit
Vorstand LIBREAS-Verein — In eigener Sache: Bericht über die Aktivitäten des LIBREAS-Vereins 2022/2023
Rezensionen
Redaktion LIBREAS — Das liest die LIBREAS, Nummer #13 (Herbst–Winter 2023)
CfP #39: Roboter und Automatisierung
Kraftwerk (1978): Roboter: https://www.youtube.com/watch?v=5DBc5NpyEoo
HAL 9000 (1968): 2001. A Space Odyssey:: https://www.youtube.com/watch?v=ARJ8cAGm6JE
Futurama Theme (2012): https://www.youtube.com/watch?v=QRk1s5Kf3aQ
Zum 100-jährigen Jubiläum des Begriffs des “Roboters” will die Ausgabe #39 der LIBREAS. Library Ideas diese Arbeiter*innen sowie generell die fortschreitende Technisierung und Automatisierung in Bibliotheken in den Fokus rücken.
Denn am 25. Januar 1921 hatte in Prag Karel Čapeks Theaterstück R.U.R. – Rossum’s Universal Robots [1] Premiere, das, in kürzester Zeit in viele Sprachen übersetzt, erfolgreich auf verschiedenen Bühnen der Welt gezeigt wurde und den Begriff des Roboters (zu dt. “Arbeiter”) in das globale Vokabular einführte. [2]
Der Einsatz der Roboter stieß zwar immer wieder auf Probleme, da die Anpassungs- und Orientierungs- und Interaktionsfähigkeit von Robotern schnell an ihre Grenzen stieß. Doch aufgrund der immer wieder verbesserten Technik wurde die Idee trotz regelmässigen Fehlschlägen nie aufgegeben und kehrt in verschiedenen Formen immer wieder zurück. Insbesondere seit die Robotik sich der Mensch-Maschine-Interaktion in der realen Welt, das heißt in natürlichen oder von und für Menschen optimierten Umwelten zugewandt hat, ist eine neue Dynamik entstanden. Aufgrund dieses Umdenkens in Richtung eines “morphologischen” Ansatzes sowie verbesserter Sensorik, Orientierung und Interaktion, sind eine neue Dynamik zu beobachten und weitere Entwicklungen in dieser Richtung zu erwarten. Das wirft jedoch bei aller technischen Begeisterung die alte Frage nach der Ersetzbarkeit menschlicher Arbeitskraft und intersubjektiver Kommunikation auf. Wollen wir Roboter – oder weitergedacht Automatisierung – in Bibliotheken? Welche Aufgaben können und sollen sie erfüllen? Und welche lieber nicht?

Technisierung & Automatisierung
Die Automatisierung von Arbeitsprozessen durch Maschinen, Roboter oder auch Software verheißt die Erleichterung der Arbeit durch die Abnahme womöglich ungeliebter und eintöniger Tätigkeiten. Dahinter steht auch das Versprechen der Verbesserung der Qualität durch formalisierte, effektivere und effizientere Arbeitsprozesse. Doch ist dies wirklich der Fall?
Oftmals sind die Prozesse störungsanfällig, die Ergebnisse fehlerhaft und benötigen doch menschliches, manchmal sehr zeitaufwendiges Eingreifen, Nachjustieren und Korrigieren. Durch die Weiterentwicklung der Technik konnten aber bereits erfolgreiche Automatisierungsverfahren entwickelt werden.
Im Bereich der Dokumentation und Inhaltserschließung wurde frühzeitig mit automatischer Texterkennung und Abstracting experimentiert. Diese wird mittlerweile flächendeckend eingesetzt. Auch Tools für die automatische Übersetzung besitzen mittlerweile eine hohe Qualität und liefern nur noch, vergleichsweise und je nach Textsorte, wenig semantischen Unsinn, siehe DeepL. [3]
Der Einsatz von Software im Alltags- und Arbeitsleben (für die Erstellung von Texten, Bearbeiten von Bildern und vieles mehr) erzeugt in der Regel keine nennenswerten Bedenken, da die diskreten Prozesse jeglicher haptischer Erfahrung entbehren und die Nullen und Einsen im Hintergrund im Idealfall zuverlässig prozessieren.
Im Bibliotheksbereich beschäftigte man sich schon relativ früh mit dem möglich Einsatz von Automatisierung, Computern und Robotern, auch wenn diese Geschichte manchmal vergessen wird. Aber gerade im Bereich der Katalogisierung wurde und wird immer wieder, auch mit Rückschlägen, versucht, die Arbeit zu automatisieren – angefangen von Katalogen auf Lochkartenrechnern bis zu heutigen Versuchen der automatischen Indexierung.
Roboter
Maschinen und vor allem Roboter hingegen teilen unseren physischen Raum und können Unwohlsein und Ängste evozieren. Im Arbeitsleben entstehen dadurch Zukunftsängste, dass die eigene Arbeit von Maschinen übernommen werden könnte und der Mensch selbst zumindest als Arbeitskraft irgendwann überflüssig wird. Darüber hinaus ist der Aufstand der Maschinen ein beliebter Topos der Science-Fiction-Literatur, zahlreicher Utopien und Filme wie der legendäre HAL9000 in Stanley Kubricks 2001. Auch Čapek’s Stück R.U.R. ist dem zuzuordnen. In diesem Übernahme-Narrativ wenden sich die Roboter irgendwann gegen ihre Schöpfer, sei es durch einen technischen Fehler (Sicherung durchgebrannt oder Ähnliches) oder auch durch die Entwicklung eines Bewusstseins einer selbständigen Persönlichkeit, die beim ersten Aufblitzen des Egos oftmals unmittelbar in dem unbedingten Drang zur Weltherrschaft münden.Und selbst dann, wenn solche Geschichten keine dystopischen Züge tragen, werfen sie regelmäßig moralische Fragen auf, die über die reine Technikbeherrschung hinausgehen: Beispielsweise kommt oft die Frage, ob der Mensch die Roboter beherrschen soll, wenn sie selber denken können oder ob die Maschinen menschliche, irrationale Züge lernen sollen? Die Roboterethik ist sicher eine philosophisches Feld mit Zukunft.
Auch wenn die Erforschung und Entwicklung künstlicher Intelligenz bereits große Fortschritte gemacht hat, begegnen uns im Arbeitsleben bisher eher harmlose Zeitgenossen. Während sich in Bibliotheken automatisierte Verfahren, wie Automaten zur Rückgabe und zum Sortieren von Medien erfolgreich etabliert haben, werden Roboter nur vereinzelt eingesetzt.
Es existieren aber durchaus populäre und preisgekrönte Beispiele, wie der humanoide Roboter Wilma der TH Wildau [4] und „Hase und Igel“ [5] im Erwin Schrödinger Zentrum in Berlin-Adlershof.
Diese Roboter werden anthromorphisiert, indem sie sympathische Namen erhalten und werden als nützliche Helferlein durchweg positiv rezipiert.
Bots
Kurioserweise erfolgt in digitalen Kommunikationsräumen, also Social Media, oft eine diskursive Umkehrung dieses Effektes: Das menschliche Gegenüber wird im Streit abwertend zum “Bot” erklärt, zum rein automatisch als Werkzeug agierenden Element, das immer die selben Nachrichten aussendet. Auch in anderen Zusammenhängen verweist der Vergleich von Menschen mit Robotern auf ein seelenloses, oft gewissenloses Handeln nach einem Programm oder Befehl. Zugleich gibt es vor allem auf Twitter tatsächlich “Social Bots”, die automatisch Nachrichten jeder Art an trendende Hashtags anbinden. Abstrakt gesehen bilden Bots aber neben Algorithmen die Grundlage aller digitaler Kommunikationsgesellschaften, wie wir sie kennen. Jede Suchmaschine setzt auf Heerscharen von “Bots”, die das Internet automatisch auslesen. Marketingagenturen (und Verlage) setzen auf Mailing-Bots, die automatisch E-Mails verschicken und dabei möglichst variiert und geschickt menschliche Autorschaft simulieren sollen, weil sie sonst in die Spamordner gefiltert und ignoriert werden. Spambots kopieren Webseiten und generieren neue Internetpräsenzen. Bot-Armeen sind unterwegs, um diese zu identifizieren und zu melden. Schadbots agieren mit dem Ziel, die digitalen Systeme zu beschädigen, zu unterlaufen, zu zerstören. In Bot-Netzen (botnets) kommunizieren schließlich Bots miteinander und bilden eigene Kommunikationsstrukturen, in denen Menschen nur noch Impuls setzen oder für das Monitoring zuständig sind. Auch im Bibliothekswesen wurden und werden Bots, vor allem für die Kommunikation mit Nutzer/innen eingesetzt, sogenannten Chatbots. Frühe Anwendungsbeispiele hierfür waren „Ina“ [6] und „Stella“ [7], zwei weiblich zu lesende Hamburger Chatbots, die bereits 2007 in LIBREAS interviewt wurden. [8] Diese beiden dienstleistungsorientierten virtuellen Assistentinnen sind jedoch nicht mehr im Dienst.
Wenn wir im 21. Jahrhundert über Roboter reden, dann müssen wir auch über die codifizierte Form – denn diese Ro-Bots sind in ihrem Kern nur Code – und ihre Semiotik, also ihre gewollte und tatsächliche Bedeutung und Wirkung sprechen.
Fragen
Die #39 der LIBREAS. Library Ideas sucht nun Texte und andere Beiträge, die sich mit den Themen Roboter, Automatisierung und Technisierung sowie Bots in physischen und digitalen Bibliotheken und anderen Organisationsformen der Wissensordnung auseinandersetzen. Dies können ganz konkrete Anwendungen sein, einer Software oder Prozessautomatisierung sowie auch reflexive Ansätze beinhalten, die Fragen behandeln wie:
- Was kann man aus, auch gescheiterten Versuchen, der Automatisierung lernen?
- Machen Automatisierung und Robotik das Leben und das Arbeiten in der Bibliothek besser?
- Wurden konkret Ressourcen eingespart oder gar Arbeitsplätze abgebaut?
- Sind die Roboter billige Arbeitskräfte / Ersatz (Čapek) oder werden sie anders gedacht / behandelt? Was kann Technik für Bibliotheken tun und wo muss man sie eventuell fürchten?
Einreichungen
Die Redaktion der LIBREAS. Library Ideas ist offen für direkte Einreichungen, aber auch für die Diskussion von Ideen für Beiträge. Formen und Inhalt sind wenig beschränkt, diese Einschränkungen sind in den Hinweisen für Autor*innen (https://libreas.eu/authorguides/) zu finden. Deadline ist der 30. April 2021.
Ihre / eure LIBREAS-Redaktion
(Aarhus, Berlin, Hannover, Lausanne, München)
Der folgende englische Text des CfP wurden mit DeepL automatisch übersetzt und ist nicht menschlich nachbearbeitet.
Einreichungen werden in deutscher und englischer Sprache akzeptiert.
Fussnoten
[1] Karel Čapek, R.U.R. – Rossum’s Universal Robots, Aventinum: Prag 1920.
[2] Siehe Helmut Hauser und Sascha Freyberg, “Form und Technik. Das morphologische Paradigma der Robotik”, in: Morphologie als wissenschaftliches Paradigma (i.V. 2021).
[3] Siehe https://www.deepl.com/translator.
[5] Siehe https://www.esz.hu-berlin.de/de/bilder/hase-und-igel.
[6] Siehe https://www.chatbots.org/virtual_assistant/Ina/.
[8] Siehe Boris Jacob, Bastian Zeinert (2007): Fragen wird immer schöner. LIBREAS. Library Ideas, 8/9, https://libreas.eu/ausgabe8/011jac.htm.
Englische Version:
CfP #39: Robots and automation
For the 100th anniversary of the term „robot“, issue #39 of LIBREAS. Library Ideas aims to focus on these workers and the increasing mechanisation and automation in libraries in general.
For on 25 January 1921 in Prague Karel Čapeks premiered the play R.U.R. – Rossum’s Universal Robots, which, translated into many languages in a very short time, was successfully shown on various stages around the world and introduced the concept of the robot (in English „worker“) into the global vocabulary.
Although the use of robots always encountered problems, because the ability of robots to adapt, orientate and interact quickly reached its limits, the concept of the robot was still in use today. However, due to constantly improving technology, the idea was never abandoned, despite regular failures, and returns again and again in various forms. Especially since robotics has turned to human-machine interaction in the real world, i.e. in natural environments or environments optimised by and for humans, a new dynamic has emerged. Due to this rethinking towards a „morphological“ approach as well as improved sensor technology, orientation and interaction, a new dynamic can be observed and further developments in this direction can be expected. However, despite all the technical enthusiasm, this raises the old question of the replaceability of human labour and intersubjective communication. Do we want robots – or more broadly speaking automation – in libraries? What tasks can and should they perform? And which ones would you rather not?
Technisation & Automation
The automation of work processes by machines, robots or even software promises to make work easier by removing possibly unloved and monotonous activities. Behind this is also the promise of improving quality through formalised, more effective and efficient work processes. But is this really the case?
Often the processes are prone to disruption, the results are flawed and yet they require human intervention, readjustment and correction, sometimes very time-consuming. However, the further development of technology has already made it possible to develop successful automation processes.
In the field of documentation and content indexing, experiments with automatic text recognition and abstracting were carried out at an early stage. This is now used throughout the country. Even tools for automatic translation are now of high quality and only deliver little semantic nonsense, comparatively and depending on the type of text, see DeepL.
The use of software in everyday and working life (for creating texts, editing images and much more) generally does not give rise to any significant concerns, as the discrete processes lack any haptic experience and ideally process zeros and ones reliably in the background.
In the library sector, the possible use of automation, computers and robots was dealt with relatively early on, even if this history is sometimes forgotten. But it is precisely in the field of cataloguing that attempts have been and continue to be made, even with setbacks, to automate work – from catalogues on punch-card computers to today’s attempts at automatic indexing.
Robots
Machines and especially robots, on the other hand, share our physical space and can evoke discomfort and anxiety. In working life, this gives rise to fears about the future, that our own work could be taken over by machines and that man himself, at least as a worker, will eventually become superfluous. Furthermore, the revolt of machines is a popular topos of science fiction literature, numerous utopias and films such as the legendary HAL9000 in Stanley Kubrick’s 2001. Čapek’s play R.U.R. can also be attributed to this. In this takeover narrative the robots turn against their creators at some point, whether through a technical error (fuse blown or similar) or through the development of a consciousness of an independent personality, which often leads directly to the unconditional urge for world domination when the ego first flashes up.and even when such stories do not have any dystopian traits, they regularly raise moral questions that go beyond the mere mastery of technology: For example, there is often the question of whether humans should dominate the robots if they can think for themselves, or whether the machines should learn human, irrational traits? Robot ethics is certainly a philosophical field with a future.
Even though research and development of artificial intelligence has already made great strides, we still encounter rather harmless contemporaries in working life. While automated procedures, such as automatic machines for returning and sorting media, have successfully established themselves in libraries, robots are only used sporadically.
There are, however, popular and award-winning examples, such as the humanoid robot Wilma from the Technical University of Wildau and „Hase und Igel“ in the Erwin Schrödinger Centre in Berlin-Adlershof.
These robots are anthromorphized by giving them likeable names and are consistently received positively as useful little helpers.
Bots
Strangely enough, in digital communication spaces, i.e. social media, this effect is often discursively reversed: the human counterpart is pejoratively declared a „bot“ in a dispute, a purely automatic element acting as a tool that always sends out the same messages. In other contexts, too, the comparison of humans with robots refers to a soulless, often unscrupulous action according to a program or command. At the same time, there are indeed „social bots“, especially on Twitter, who automatically link messages of all kinds to trendy hashtags. In the abstract, however, bots, along with algorithms, form the basis of all digital communication societies as we know them. Every search engine relies on hosts of „bots“ that automatically read the internet. Marketing agencies (and publishers) rely on mailing bots that automatically send out e-mails and are supposed to simulate human authorship in as varied and skilful a manner as possible, because otherwise they will be filtered into spam folders and ignored. Spambots copy websites and generate new websites. Bot armies are on their way to identify and report them. Malicious bots act with the aim of damaging, undermining, destroying digital systems. Finally, in botnets, bots communicate with each other and form their own communication structures in which people only set impulses or are responsible for monitoring. Bots have also been and continue to be used in libraries, especially for communication with users, so-called chatbots. Early application examples of this were „Ina“ and „Stella“, two Hamburg chat bots to be read by women, which were already interviewed in LIBREAS in 2007. However, these two service-oriented virtual assistants are no longer in service.
When we talk about robots in the 21st century, we must also talk about their codified form – because these ro-bots are only code at their core – and their semiotics, i.e. their intended and actual meaning and effect.
Questions
The #39 of the LIBREAS. Library Ideas is now looking for texts and other contributions that deal with the topics of robots, automation and mechanisation as well as bots in physical and digital libraries and other forms of organisation of the knowledge order. These can be very concrete applications, of software or process automation as well as reflective approaches that address questions such as:
- What can be learned from automation, even failed attempts?
- Do automation and robotics make life and work in the library better?
- Have resources been saved or even jobs cut?
- Are the robots cheap labour / replacement (Čapek) or are they thought / treated differently? What can technology do for libraries and where do you possibly have to fear it?
Submissions
The editorial office of LIBREAS. Library Ideas is open for direct submissions, but also for the discussion of ideas for contributions. There are few restrictions on form and content, these restrictions can be found in the notes for authors (https://libreas.eu/authorguides/). Deadline is 30 April 2021.
Your LIBREAS editorial office
(Aarhus, Berlin, Hannover, Lausanne, Munich)
The following English text of the CfP was automatically translated with DeepL and is not human-edited.
Submissions are accepted in German and English.
Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
5 Fragen zur Nachhaltigkeit von Forschungsinfrastrukturen
Die Ausgabe #36 LIBREAS. Library Ideas wird den Schwerpunkt „Nachhaltigkeit von Forschungsinfrastruktur” haben. Für diese Ausgabe suchen wir Beiträge, die ergründen, wie Infrastrukturen für die Forschung so geschaffen, unterhalten und weiterentwickelt werden können, dass sie auch wirklich nachhalten – sie also über einen längeren Zeitraum, unter sich ändernden Bedingungen, Zuständigkeiten oder für sie verantwortliche Personen, für Forschung beziehungsweise von Forscher*innen nutzbar sind.
Wie üblich suchen wir sowohl Berichte aus der Praxis als auch theoretische Auseinandersetzungen verschiedener Form (Essays, Arbeitsberichte, Abschlussarbeiten usw.). Einen Überblick zu geplanten Ausgabe gibt der Call for Papers im LIBREAS-Blog.

Symbolbild Infrastruktur: Leitungen, Wasserversorgung, das Berliner Straßenpflaster und weitere übliche Zubehörelemente der mobilen und dauerhaften städtischen Raumorganisation – ein Straßenbild in der Burgstraße, Berlin-Mitte, 2019 (Foto: Ben Kaden / Flickr, CC BY 2.0)
Ergänzend möchten wir wieder fünf Fragen stellen und damit kurze Einblicke zusammentragen. (ähnlich zur Rubrik in der Ausgabe #33 Ortstermin). Dafür wünschen wir uns von möglichst vielen Betreiber*innen, Entwickler*innen und Mitarbeiter*innen von Forschungsinfrastrukturen Antworten auf die folgenden fünf Fragen.
- An welcher Einrichtung sind Sie tätig und welche Art von Forschungsinfrastruktur wird an ihr betrieben bzw. genutzt? (Mehrfachnennungen möglich)
- Wie ist das Finanzierungsmodell für diese Forschungsinfrastruktur(en) gestaltet?
- Welche Rolle spielt Kollaboration mit anderen Einrichtungen für Betrieb und Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur(en)?
- Welche Rolle spielen freie Lizenzen und andere Kriterien offener Wissenschaft in diesem Zusammenhang?
- Ist die Forschungsinfrastruktur aus Ihrer Sicht nachhaltig? Warum (nicht)? Falls nicht: Was fehlt, um den nachhaltigen Betrieb abzusichern?
Bildmaterial ist ebenfalls willkommen; es sollte sich allerdings um eigene oder frei lizenzierte Bilder handeln, die eine Nachnutzung bei LIBREAS nach der bei uns üblichen Standardlizenz auch ermöglichen.
Wir freuen uns über Antworten an redaktion@libreas.eu bis zum 15.10.2019. Die Beiträge werden gesammelt in der Ausgabe 36 erscheinen und damit – so die Hoffnung – einen Überblick über eine Vielfalt von Projekten und Initiativen sowie Herausforderungen und Lösungen aus der Praxis geben.
(red)
LIBREAS auf dem Bibliothekskongress 2019
Wenn sich große Teile der Bibliotheksszene im März in Leipzig auf dem Bibliothekskongress treffen werden, wird auch die LIBREAS-Redaktion (zumindest ein Teil) dort weilen. Sie treffen uns / ihr trefft uns in folgenden Veranstaltungen.
Gerne laden wir vor allem zum gemeinsamen Treffen respektive Chillen mit der Redaktion am Montag-Abend ein.
Montag, 18.03.2019
- Karsten Schuldt: Warum funktioniert mein partizipatives Projekt nicht richtig? Kritik und Fallstricke (11:00-11:30, Saal 3)
- Treffen / Chillen mit der Redaktion im “Volkshaus Leipzig” (19:00- open end, Karl-Liebknecht-Straße 30-32, zwischen Tram-Station “Hohe Straße” und “Südplatz”, http://www.volkshaus-leipzig.de/)
Dienstag, 19.03.2019
- Karsten Schuldt, Alexandra Jobmann, Peter Jobmann, Maik Stahr: Die Bibliothek als gesellschaftliche Institution – #critlib (Teil 2) (09:00-11:00, Beratungsraum 3)
Mittwoch, 20.03.2019
- Linda Freyberg, Sabine Wolf: Smart Libraries – Mit Beispielen, Modellen und Methoden zur Bibliothek der Zukunft. Hands-On Lab analog (09:00-11:00, Beratungsraum 2)
- Najko Jahn, Uwe Müller: DINI Metadata Crunch: Praktische Schritte zur Nachnutzung von Metadaten aus DINI-zertifizierten Repositorien (16:00 – 17:30, Seminarraum 13)
Die Erklärung von Stavanger mit einem Schwenk zum Open Access. Serviert in der FAZ.
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)

Screenshot FAZ 13.02.2019 / Screen oder Zeitung? In den pressevertriebsstrukturschwachen Regionen auch Berlins ist das keine Frage. Allein deshalb sollte die FAZ die Digitalisierung umarmen und in der Vertriebspraxis tut sie das auch. Thomas Thiel hat dennoch seine Zweifel und sieht sie nach Stavanger bestätigt.
Die Frage „Buch oder Bildschirm?“, also auf welcher Medienoberfläche sich besser lesen lässt, treibt die Welt faszinierenderweise auch 2019 um – zum Beispiel im „Forschung und Lehre“-Teil der FAZ vom 13.02.2019. Der Anlass für Thomas Thiel (hier als tth) besteht in der so genannten Stavanger-Erklärung („E-READ“, weiter Informationen) zur Lesekompetenz. Deren Haupteinsicht lautet in etwa, dass das Lektüreziel die Wahl des Lektüremediums bestimmt und Gedrucktes besser für ein Tiefenverständnis funktioniert. Der FAZ-Redakteur versucht nun zu beleuchten, was die nicht gerade überraschende, nun aber empirisch nochmals verifizierte Erkenntnis, dass Papier nach wie vor Relevanz und Wert in der Rezeptionskultur besitzt und vermutlich behalten wird, für die Digitalisierungsstrategien in der Wissenschaft bedeutet. Dass die Textpraxis der wissenschaftlichen Kommunikation kein Gegenstand der Stavanger-Perspektive selbst war, spielt dabei offenbar keine Rolle. Für die Lehre sind die Einsichten fraglos hochrelevant und Erfahrungen aus der Lehrpraxis zeigen, dass die Frage wie viel und wie komplex Text für Studierende sein sollte, jede Semesterplanung maßgeblich prägt. Neu ist diese Frage freilich ebenfalls nicht. (more…)
Sophie Schneider fährt zu den Open-Access-Tagen 2018. Mit Unterstützung von LIBREAS

Sophie Schneider – die erste LIBREAS-Reisestipendiatin (Foto: privat)
Sophie Schneider fährt nach Graz. Jedenfalls hoffen wir als LIBREAS, dass sie das tut. Und wir unterstützen sie mit Freude und mit allem, was wir bieten können, also unserem Reisestipendium. Denn ihr Motivationsschreiben für das von uns ausgelobte Reisestipendium für den Besuch der Open-Access-Tage 2018 überzeugte hat uns außerordentlich. Als angehende Bibliotheksmanagerin, sie studiert aktuell an der Fachhochschule Potsdam, sind Veranstaltungen wie diese naturgemäß mehr als irgendein Konferenzbesuch, um den Anschluss an aktuelle Diskussionen zu halten. Aus eigener Erfahrung können wir berichten, dass Studierende mit solchen Reisen ihren Blick auf die Bibliothekswelt und ihre mögliche Position darin sehr erweitern, manchmal auch grundsätzlich verändern können. Es ist uns daher eine große Ehre, diese Tür im Rahmen unserer Möglichkeiten, nun auch Sophie Schneider zu öffnen. Denn dies ist die Motivation hinter dem LIBREAS-Reisestipendium: Menschen, die sonst womöglich nicht so einfach die Mittel haben, um zu einer Konferenz zu reisen, bei der Teilhabe zu unterstützen. Will man es ganz groß aufspannen, ist es auch eine Investition in das Bibliothekswesen, das weitsichtige, engagierte, kompetente Persönlichkeiten immer benötigt und aktuell natürlich besonders.
In ihrem Bewerbungsschreiben formulierte Sophie Schneider die Frage:
„Wo können wir als Bibliotheks- und Informationswissenschaftler/innen die Fachwissenschaftler/innen beim Publikationsprozess
unterstützen, vielleicht sogar mit der Entwicklung entsprechender Strukturen und Technologien?“
Die Open-Access-Tage an der Technischen Universität Graz sind in diesem Jahr genau der richtige Ort, um darüber zu diskutieren.

Ein Blick auf Graz im Februar. Im Spätsommer zeigt es sich selbstverständlich deutlich leuchtender. Nur haben wir bisher kein entsprechendes Bild im Archiv. Aber vielleicht bringt uns Sophie Schneider eines mit. (Foto: Ben Kaden)
Wer vorab in einen entsprechenden Austausch mit Sophie Schneider einsteigen möchte, sollte sich mit ihr schon vorab über Twitter verknüpfen: https://twitter.com/BibWiss. Wir empfehlen darüberhinaus auch einen Blick in ihr Weblog. Und wir freuen uns auf eine rege Berichterstattung im September, die wir in jedem Fall auch an dieser Stelle so sichtbar wie möglich machen.
Darüber hinaus hoffen wir, dass wir dem Reisestipendium einen wichtigen Beitag zum Vereinsziel des LIBREAS e.V. leisten, nämlich für die “ Förderung der bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Kommunikation“. Weitere Anregungen, Ideen und natürlich auch Unterstützungen sind wie immer sehr willkommen. Der anstehende Bibliothekartag / Bibliothekstag 2018 in Berlin bietet zudem die Möglichkeit, persönlich mit uns in Kontakt zu treten. Ansonsten immer sehr gern über mail@libreas-verein.eu, redaktion@libreas.eu oder auf Twitter: @libreas.
(red. / Berlin im Juni 2018)
LIBREAS. Library Ideas auf dem Bibliothekstag 2018 in Berlin
Bekanntlich ist der Bibliothekstag das grösste bibliothekarische Treffen im deutschsprachigen Raum. Die LIBREAS. Library Ideas wird auf und bei ihm – wenn er schon in Berlin ist, der Stadt zu dem die ganze Redaktion einen Bezug hat – zu treffen sein, in unterschiedlichen Funktionen: Am Mittwochabend beim offenen “Chillen mit der Redaktion”, auf Vorträgen und Workshops, auf Ständen und als Besucher*innen. Hier eine kurze Übersicht, wo Sie/ihr uns persönlich treffen können. Kommen Sie/Kommt doch vorbei.
Chillen mit der Redaktion (Mittwoch, 13.06.2018)
Am Mittwochabend, nach der Konferenz, laden wir Sie/euch ein, mit uns gemeinsam die doch etwas tristen langweiligen Hallen des Konferenzzentrums zu verlassen und einen ordentlichen Berliner Abend zu verbringen. Wir treffen uns ab 19:00 im Birgit&Bier. (http://birgit.berlin/, Adresse: Schleusenufer 3, 10997 Berlin, Stationen in der Nähe: S-Bhf. Treptower Park, Bus Heckmannufer oder U-Bhf. Schlesisches Tor. Mit der S-Bahn vom Kongressort gut zu erreichen.) Kommen Sie/kommt gerne vorbei und machen Sie/macht das, was man in Berlin macht: Mate trinken, Buletten essen oder lieber was Veganes, rumhängen und über Tische hinweg quatschen. Oder was Ihnen/euch gefällt, man ist da bekanntlich sehr offen in Berlin.
Vorträge und Project-Labs
Dienstag (12.06.2018)
- 13:00-13:30. Karsten Schuldt: Bibliothek und Armut: Was kann die Öffentliche Bibliothek wirklich tun? (Raum V)
- 15.30–18.00. Michaela Voigt (u.a.): Hands-on-Lab Zweitveröffentlichungen (Lab II)
Mittwoch (13.06.2018)
- 14:30-15:00 Najko Jahn: Hybrid OA Dashboard: ein Analysewerkzeug zur Open Access Transformation wissenschaftlicher Journale (Raum III)
- 17:00-17:30 Linda Freyberg: Augmented Library – Konzeption einer App für die Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin-Pankow (Raum IV)
Donnerstag (14.06.2018)
- 09:00-13:00: Matti Stöhr, Michaela Voigt (u.a.): Kooperative Entwicklung der Kriterien für den Open Library Badge 2018 (Project Lab)
- 10:30-11:00. Karsten Schuldt: Die Entwicklung der Schulbibliotheken in Berlin 2008-2017: Ergebnisse einer zehnjährigen Studie (Estrel Saal A)
- 14:00-18:00. Karsten Schuldt, Peter Jobmann, Maik Stahr, Alexandra Jobmann: Die Bibliothek als gesellschaftliche Institution? #critlib auf deutsch? Ein Zine-Projekt (Project Lab)
Fünf Bilder / Fünf Fragen über meine Bibliothek
Die Ausgabe #33 der LIBREAS. Library Ideas wird den Schwerpunkt “Ortstermin. Reportagen aus der tatsächlichen Bibliotheksarbeit” haben. Wir suchen für diese Ausgabe weiterhin Beiträge, die sich damit beschäftigen, was in den Bibliotheken Tag für Tag passiert (https://libreas.wordpress.com/2017/10/04/cfp-libreas-library-ideas-33-ortstermin-reportagen-aus-der-tatsaechlichen-bibliotheksarbeit/).
Wir wollen aber auch dazu einladen, für diese Ausgabe an einer kleinen Umfrage teilzunehmen. Fünf Bilder und fünf kurze Beschreibungen zu diesen Bildern sollen Bibliotheken vorstellen. Uns interessieren dabei nicht die Presseberichte oder langen Erklärungen, warum etwas neu oder besser oder schöner ist, sondern Photos aus realen Bibliotheken mit Anmerkungen von realen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Eingeladen sind alle Formen von Bibliotheken, egal ob klein oder gross, neu gebaut oder schon lange nicht mehr renoviert.
Die Umfrage finden Sie / findet ihr unter diesem Link: https://goo.gl/forms/lMvBC7RJJ4KoiAkw1 Sie ist jetzt offen, wir werden sie Ende Dezember (31.12.2017) schliessen.
Jana Rumler, Leiterin der Bibliothek des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im Bereich der bibliothekarischen Dienste hat diese Umfrage schon einmal (als Inspiration für andere) ausgefüllt. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich / ihr euch mit Ihrer Bibliothek beteiligen / beteiligt. Wir werden die Antworten der Umfrage in der genannten Ausgabe veröffentlichen. (Dazu müssen die Rechte an den Bildern bei Ihnen liegen, was vor allem dann der Fall ist, wenn Sie / ihr diese selber machen / macht.)
Vielen Dank für die Beteiligung.
Redaktion LIBREAS. Library Ideas
___________________________________
Antworten von Jana Rumler
1. Zeigen Sie uns den Ort in Ihrer Bibliothek, an dem Sie die meiste Zeit verbringen.

Was ist das für ein Ort? Wieso sind Sie die meiste Zeit dort?
Hier sieht man die Treppe, die beide Etagen der Bibliothek des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. verbindet. Der Ort steht für das Arbeiten in der physischen und digitalen Welt: zwischen hunderten Regalmetern in dunkelbraunem Leder gebunden Zeitschriftenbänden und einer virtuellen Forschungsumgebung.
2. Was würden Sie vermissen, wenn es nicht mehr da wäre?

Wieso würden Sie es vermissen?
Als wissenschaftliche Spezialbibliothek im Bereich der Umweltwissenschaften spielen Zeitschriften als maßgeblicher Publikationsort eine entscheidende Rolle. Hier zu sehen sind leer geräumte Zeitschriftenaufsteller. Einige wenige Zeitschriften beziehen wir noch in print, 90% unseres heute erworben „Bestandes“ stellen wir unseren Nutzern digital zur Verfügung. Das haptische Gefühl für die Zeitschriftenhefte geht verloren.
3. Was stört Sie an Ihrer Bibliothek beziehungsweise was würden Sie gerne verbessern?

Wieso stört Sie das jetzt (noch)?
Unsere, im Sinne der Raumplanung beinahe wieder modern wirkende, Bestandsaufstellung nach Numerus currens und nach den Publikationformen monographische Werke, Schriftenreihen und Zeitschriften. Serendipity ist nur in begrenztem Maße möglich.
4. Zeigen Sie uns Spuren der Bibliotheksnutzung.

Gibt es dazu ein Geschichte?
Hier zu sehen ist der abgenutzte Teppich am Arbeitsplatz des Tresens. Er steht für unser stetiges Engagement unserer NutzerInnen bedarfsgerecht mit den Informationen zu versorgen, die sie benötigen. Er steht gleichzeitig für die aktuellen und ehemaligen MitarbeiterInnen unserer Bibliothek, die unermüdlich zwischen Tradition und Innovation wandeln.
5. Was haben Sie, was die anderen nicht haben?

Warum haben Sie das? Sollten andere es auch in ihren Bibliotheken haben?
Historisch bedingt, entschied man sich vor rund 10 Jahren das Publikationsmanagement an die Bibliothek anzugliedern. Eine Situation, die heute dafür sorgt, dass wir im aktuellen Spannungsfeld Open Access-Publizieren, Lizenzmanagement und Bibliometrie/Szientometrie eine Serviceangebot haben, das innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft selten für die kleineren Bibliotheken zu finden ist, den aktuellen Anforderungen an das Berufsbild der Bibliothekars aber nahe kommt.
Ihre Bibliothek (Name, Adresse, Spezialisierung, was man noch über sie wissen sollte)?
Bibliothek des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. KOBV-Bibliothek, 2,5-3,5 Vollzeitäquivalente. Interdisziplinäres Sammelgebiet zur Landschaftsforschung.
Sie selber (Name, Funktion, was man noch über Sie wissen sollte)?
Jana Rumler, Leiterin der Bibliothek im Bereich der bibliothekarischen Dienste. Open Science-Multiplikatorin, mit Hang zu Informationskompetenzvermittlung und Vernetzung kleinerer wissenschaftlicher Spezialbibliotheken. Interessiert an informationsethischen Fragestellungen.
CfP LIBREAS. Library Ideas #33: Ortstermin. Reportagen aus der tatsächlichen Bibliotheksarbeit
Die bibliothekarische Literatur hat einen erstaunlichen Bias: Der Alltag, also das, was in Bibliotheken Tag für Tag, Woche für Woche gemacht wird, kommt in ihr kaum vor. Neue Projekte, innovative Veranstaltungen, erstaunliche Bauten finden immer wieder Platz in den bibliothekarischen Zeitschriften, Überlegungen zur Zukunft der Bibliotheken und Medien erst Recht; aber das, was nicht sofort als innovativ, verändernd oder erstaunlich beschrieben werden kann, ist in der Literatur fast unsichtbar. Dabei ist es diese alltägliche Arbeit, die überhaupt erst die Basis für alle neuen Projekte bietet; es ist auch diese Arbeit, die von den Nutzerinnen und Nutzern wahrgenommen wird. Zu vermuten ist, dass sie die Bibliotheken vor allem wegen diesem alltäglichen Funktionieren als Institution, als Raum, als Idee besuchen – und nur zu einem kleinen Teil wegen der so oft beschriebenen Innovationen. (Und selbst diese Innovationen werden schnell zum Alltag, wenn sie funktionieren.) Auch das Personal in den Bibliotheken ist vor allem mit dem Alltag befasst. Nur eben die bibliothekarische Literatur (und bibliothekswissenschaftliche Forschung) selten.
Ein Grund dafür ist selbstverständlich, dass das Neue, Innovative, Verändernde oft erst einmal interessanter klingt und dadurch für die Publikation geeigneter. Aber der Alltag ist eher das, was interessant ist, wenn man verstehen will, warum Bibliotheken funktionieren, wie sie funktionieren, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen, warum sie so beliebt sind bei einer doch erstaunlich großen Anzahl von Menschen. Mit dem Fokus auf Innovationen und Veränderungen entsteht oft der Eindruck, der bisherige Alltag wäre rückständig, mitunter falsch und vor allem zu überwinden. Während es auch nicht richtig wäre, Veränderungen abzulehnen, scheint dieser Fokus doch auch viel zu übersehen. Es wird Gründe geben, warum Bibliotheken bestimmte Dinge immer und immer wieder tun. Diese werden jedoch nur sichtbar, wenn man sich den Alltag anschaut. Es gibt in den Bibliotheken immer wieder lokale Lösungen, die an diesen konkreten Orten besonders sinnvoll sind und auch etwas darüber sagen, wie Bibliotheken in ihren jeweiligen Communities funktionieren. Und es gibt immer wieder Veränderungen in Bibliotheken, die weniger sichtbar sind, auch weil sie kleinteilig oder natürlich oder trivial erscheinen. Aber dass Bibliotheken heute viel offener erscheinen, als vor einigen Jahrzehnten ist nicht nur das Ergebnis von radikalen Veränderungen, sondern von zahllosen so kleinen wie wirksamen Schritten. Auch das wird nur sichtbar, wenn man den Blick auf den Alltag der Bibliotheken lenkt.

Ben Kaden: Das Licht. / 07.07.2017 (CC BY-NC 2.0, https://www.flickr.com/photos/benkaden/36227519221) #Berlin
#Marzahn #Victor-Klemperer-Platz #Freizeitforum Marzahn #Wolf-Rüdiger Eisentraut #Bibliotheksbau #Bibliotheksarchitektur #Architektur der DDR #Architektur #2017 #07.07.2017 #Ostmoderne
Nicht zuletzt aber ist es der Alltag, der viele Kolleginnen und Kollegen dazu bringt, Tag für Tag und Jahr für Jahr weiter aktiv und begeistert in ihrer Bibliothek zu arbeiten und nicht die Stelle oder das Feld zu wechseln. Es gibt auch immer persönliche Erfolgsgeschichten, es wird immer auch ein Sinn in der eigenen Arbeit gesehen.
LIBREAS. Library Ideas möchte in ihrer Ausgabe #33 vor allem diesem Alltag auf die Spur kommen. Uns interessieren Berichte aus diesem Alltag: Was passiert da eigentlich Tag für Tag in der Bibliothek? Was machen die Menschen sowie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wirklich? Dabei geht es nicht um die großen Geschichten, die massiven Veränderungen, sondern um das vermeintlich Kleine, Nebensächliche, Alltägliche. Also das, was passiert, wenn die Türen geöffnet werden, wenn Veranstaltungen, welche die Bibliothek regelmässig durchführt, stattfinden, wenn die Schulklassen in die Öffentliche Bibliothek kommen oder die neuen Studierenden in die Wissenschaftliche Bibliothek. Wie ist das in Ihrer Bibliothek, wenn das Wetter wechselt und die Tage länger oder kürzer werden? Wie ist das, Medien einzustellen am Morgen oder am Informationspult zu sitzen am Nachmittag oder die Bibliothek am Abend zu schließen und die letzten Personen in den Abend zu entlassen?
Es geht um persönliche Erfahrungen und Berichte, um Reportagen – gerne auch improvisiert, gerne auch mit vielen Bildern und wenig Text –, um Interviews über die persönliche Motivation von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren (zum Beispiel Ihren direkten Kolleginnen und Kollegen oder auch gerade Ihnen selber). Nichts ist zu klein, zu unwichtig oder zu wenig relevant, sondern gerade das, was oft als normaler Alltag in der Bibliothek angesehen wird, interessiert uns. Die Ausgabe #33 “Ortstermine” soll genau das sein: Besuche vor Ort, in den Bibliotheken, großen und kleinen, Öffentlichen und Wissenschaftlichen, auf dem Land und in der Stadt. Jede Bibliothek glänzt mit ihrem Alltag, nicht nur mit ihren Innovationen.
Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen in den Bibliotheken auf, solche Reportagen einzureichen. Gerne unterstützen wir Sie bei beim Verfassen der Texte oder diskutieren Ideen für Beiträge. Einreichungsschluss ist der 31.01.2018.
Eure / Ihre Redaktion LIBREAS. Library Ideas
(Berlin, Chur, Dresden, Hannover, München)
Publikationsfreiheit.de, Open Access und Geisteswissenschaften.
Eine Notiz von Ben Kaden (@bkaden)
I
Der Aufruf „Publikationsfreiheit für eine starke Bildungsrepublik“ (www.publikationsfreiheit.de) war unbestreitbar eine prägendes Ereignis der Debatten und Kontroversen vor allem aber nicht nur um das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG). Er verfehlte allerdings, wie wir nun wissen, sein unmittelbares Ziel. Der Bundestag beschloss selbst angesichts der Unterschriften von Jürgen Habermas, Jürgen Osterhammel und Marlene Streeruwitz eine Neuregelung der Urheberrechtsschranken im deutschen Urheberrechtsgesetz, die dank eines Zugeständnisses an die Presseverlage kurz vor Beschluss die Reichweite der Schranken leicht begrenzen, punktuell ein paar Lücken schließen (Textmining) und sichert insgesamt die Situation, die sich aus den drei berühmten Körben der deutschen Urheberrechtsgeschichte ergab, in neuen Formulierungen. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass der Aufruf nichts als diskursive Aquafitness war. Ganz im Gegenteil.
Das gilt in vielerlei Hinsicht. So dürfte die Vernetzung und Willensbildung im deutschen Verlagswesen und im Börsenverein des deutschen Buchhandels einen erheblichen Schub erfahren haben. Zugleich präsentiert er in hochkonzentrierter Form und im Zusammenhang mit anderen Quellen der absolvierten Urheberrechtsdebatte, wie öffentliche Auseinandersetzungen dieser Art mit welchen Narrativen unterfüttert öffentlich kommuniziert werden, wie sich welche Öffentlichkeit mobilisieren lässt und welche Akteure welche Kanäle zu aktivieren in der Lage sind. Wir wissen nun in gewisser Weise, wie vital die Beziehungen zwischen Verlagen und ihren Autorinnen und Autoren sind und wer für welche Botschaften besonders empfänglich ist.
Zugleich sind der Aufruf und seine Spuren aber auch als diskursgeschichtliche Forschungsdaten hochinteressant. Glücklicherweise ist die Seite mittlerweile auch im Internet Archive gesichert. Insbesondere die rege genutzte Möglichkeit, einen Kommentar zur Vorlage „Ich unterstütze die Publikationsfreiheit, weil…“ zu hinterlassen, kumulierte nämlich einen außerordentlichen und einzigartigen qualitativen Datenpool zu Einstellungsmustern in Verlagswesen, Wissenschaft und Kulturproduktion gegenüber aktuellen Entwicklungen im Publikationswesen und insbesondere im wissenschaftlichen Publizieren. Spätere Analysen zum Medienwandel und seinem Echo in den 2010er Jahren werden darauf dankbar zurückgreifen. Wenngleich naturgemäß nicht repräsentativ, gibt das Material doch exemplarisch Zeugnis zur Debattenkultur unserer Gegenwart. (more…)
leave a comment