Von Digitalfundamentalisten und Zentralisierungswünschen
Zu: Michael Knoche (2018): Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft (2. Auflage). Göttingen: Wallstein, 2018
Karsten Schuldt
„Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft” ist ein Buch, welches stark an Polemik, aber inhaltlich weder überzeugend noch konsistent ist.
Von Beginn an: Der Autor, Michael Knoche, war lange Jahre (inklusive der Zeit des Brandes und Wiederaufbaus) Direktor der Anna Amalia Bibliothek in Weimar und scheint als solcher eine starke Meinung zu verschiedenen Themen des Wissenschaftlichen Bibliothekswesens entwickelt zu haben. Im genannten Buch versucht er, diese zu vermitteln. Selbstverständlich ist er dabei fachkompetent.
Das Buch selber ist erstaunlich kurz. Die einzelnen, 16 Kapitel sind jeweils vielleicht 5 Seiten lang. Zudem ist es an vielen Stellen unterhaltsam zu lesen: Der Autor versucht sich immer wieder in Polemik und Sprachbildern, die nicht immer funktionieren, aber von Überzeugungen zeugen.
Was der Autor allerdings sagen will und vor allem, gegen wen er anschreibt, das ist schwer fetszustellen. Ebenso schwer ist zu sagen, an wen er sich eigentlich richtet. Vom Thema ausgehend könnte vermutet werden, dass er ins Bibliothekswesen hinein intervenieren will. Viele seiner Andeutungen sind wohl nur für die verständlich, die einen bibliothekarischen Hintergrund mitbringen. Gleichzeitig aber scheint der Autor sich an eine breit Öffentlichkeit oder aber die Politik zu richten, da er ständig Konzepte wie Open Access, Provenienzforschung oder Formen der Fernleihe erläutert, die man im Bibliothekswesen als bekannt voraussetzen kann. Am Ende des Buches ist dann auch nicht klar, von wem er eigentlich was fordert.
Sichtbar ist, dass er eine Personengruppe ablehnt, die er mal „Digitalfundamentalisten” (47 u.a.), mal als „Bibliothekare[, die] unter einer rätselhaften Form des Bücherverdrusses [leiden]” (11) bezeichnet. Wer genau zu dieser Gruppe gehört oder was diese Gruppe genau ausmacht, wird nicht benannt. Einzig Rafael Ball (ETH Zürich) und Rick Anderson (University of Utah) werden genannt, aber das ist keine Gruppe. Man würde vermuten, dass im Laufe des Buches durch Abgrenzungen klar wird, was diesen „Digitalfundamentalisten” vorzuwerfen sei, aber das passiert nicht. Der Autor selber ist überhaupt nicht konsistent in dem, was er positiv oder negativ findet. Er hebt, selbstverständlich, auch ständig Vorteile des digitalen Kommunizierens, Publizierens und Aufbewahrens (also vor allem des Scannes von Büchern) hervor. Er ist also kein Luddit. Vielleicht meint er, dass „Digitalfundamentalisten” einfach immer und überall gedruckte Medien ablehnen würden, was so (die Bücher von Rafael Ball sind z.B. auch gedruckt zu erhalten, ebenso wie die von ihm herausgegeben B.I.T. Online) auch nicht stimmt. Es scheint eher, als hätte der Autor ein Feindbild und würde davon ausgehen, dass wir, die Leserinnen und Leser, dieses ohne grosse Erklärung auch teilen würden. (Zumindest der Rezensent ist gehört nicht zu dieser Gruppe und kann deshalb mit dem Begriff nicht wirklich etwas anfangen.)
Der Titel, der Klapptentext und das einleitende Kapitel des Autors versprechen, über die „Idee der Bibliothek” und die Zukunft der Bibliotheken – eingeschränkt auf die Wissenschaftlichen Bibliotheken – nachzudenken. Davon findet sich im Buch fast nichts. Es wird nicht argumentiert oder nachgedacht, vielmehr scheint der Autor einige Überzeugungen zu haben, die er mitteilen will. Das Problem ist nicht, dass er Überzeugungen hat. Ohne solche wäre vielleicht kein guter Bibliotheksdirektor gewesen. Das Problem ist, dass er nicht einmal den Versuch unternimmt, zu überzeugen. Er scheint auch hier davon auszugehen, dass es keiner weiteren Ausführungen bedürfte, sondern das einfach dadurch, dass er seine Überzeugungen äussert, diese zu Wahrheiten würden. Das hält das Buch kurz, aber es erreicht nur die, die eh schon seiner Meinung sind. Beispielsweise betont er, dass Bibliotheken (alle Bibliotheken) den Auftrag hätten, langfristig und umfassend zu sammeln. (Das ist dann auch schon die „Idee der Bibliothek” aus dem Buchtitel.) In einem Kapitel betont er dann noch, dass nur dieses Sammeln es möglich macht, historisch zu arbeiten, zumal bei sich ständig wandelnden Paradigmen der Geschichtswissenschaft. Aber anschliessend geht er einfach davon aus, dass dies allgemein akzeptierter Fakt sei. Es ist, wie weiter oben gesagt, eine Polemik. Gäbe es aber zum Beispiel die Gruppe der Digitalfundamentalisten wirklich und würde diese auch nur inhaltlich konsistent argumentieren, egal was, wäre sie überzeugender, als dieses Buch.
Die Überzeugungen, welche Knoche vorträgt, sind zudem auch nicht originell. Sie lassen sich in drei Thesen zusammenfassen:
- Aufgabe der Bibliotheken ist das umfassende und nachhaltige Sammeln
- Digitalfundamentalisten würden diese Aufgabe bedrohen (weil das Digitale nicht einfach zu sammeln wäre, sondern – weil es ja Lizenzen sind – gesonderter Regeln bedürfe und selbstverständlich einer Klärung, wie man überhaupt Digitales nachhaltig sammeln kann; alles Fragen, die im Bibliothekswesen auch ohne die Polemik dieses Buches besprochen werden): „Nur wenn die Sammlungen ihr Eigentum sind, können sie [die Bibliotheken] versuchen, sie dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Bibliotheken müssen Bestand halten.” (9)
- Notwendig sei eine Zentralisierung von Aufgaben, entweder durch zentrale Einrichtungen (Knoche meint, dass die DFG dies nicht – mehr – tun würde oder könnte, sondern der Bund eingreifen müsste) oder aber durch enge Kooperation der Bibliotheken (wobei er dann für Bibliotheken mehr Autonomie fordert und – offenbar ohne Kenntnis der tatsächlichen Lage in der Schweiz – unter anderem die schweizerischen Bibliotheken als positives Beispiel darstellt)
Gerade diese letzte Idee einer nationalen Koordination der bibliothekarischen Aufgaben scheint Knoche umzutreiben. Aber auch hier: Das wird nicht begründet, es wird einfach behauptet, dass es anders nicht mehr möglich wäre, zu sammeln. Gezeigt oder gar nachgewiesen wird das nicht. Die reine Behauptung vonseiten des Autors soll offenbar alleine ausreichen. Ausgehend von dieser Behauptung fordert er dann – allerdings unklar, von wem – wieder einmal eine Nachfolgeeinrichtung des Deutschen Bibliotheksinstituts und eine Wiedereinführung der langfristigen Finanzierung der Sondersammelgebiete.
Wie gesagt: Dieses Buch überzeugt wohl niemand von irgendetwas. Es liefert auch, ausser dem polemischen Begriff der Digitalfundamentalisten (übrigens durchgängig männlich, deshalb auch in dieser Besprechung so zitiert), keine neuen Ideen. In einigen Bereichen sind die Überzeugungen des Autors auch erstaunlich konservativ, beispielsweise spricht er sich – aber da ist er mit anderen Autoren des herausgebenden Wallstein Verlages, wie Uwe Jochum einer Meinung – gegen eine Verpflichtung von Forschenden zu Open Access aus, weil dieses die Wissenschaftsfreiheit einschränken würde. Vielleicht spiegelt es die Überzeugungen vieler deutscher (?) Bibliotheksleitungen wider. Wenn dem so wäre, würde es aber auch eine Schwäche dieser Überzeugungen offenlegen, nämlich dass sie nicht argumentativ oder mit Fakten untermauert sind.
Es ist aber, wie gesagt, vergnüglich zu lesen. Aber eher wie ein Grime-Track, dem man wegen der Sprachbilder und dem gekonnten Springen durch die Themen und Beleidigungen Respekt zollt, nicht wegen des Inhalts.
LIBREAS #24: Zukünfte erschienen
Diese Zukunft liegt hinter uns: Mit großer Freude verkünden wir, dass die 24. Ausgabe der LIBREAS mit dem Titelthema Zukünfte erschienen ist. Wie immer freuen wir uns und hätten vor Kurzem noch nicht geglaubt, dass es klappen würde. Aber da ist, mit Artikeln über gewünschte, erspähte, zu verhindernde, zu diskutierende und vergangene Zukünfte. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Diskutieren.
(Und auf zur nächsten Ausgabe, LIBREAS #25: Frauen.)
Redaktion LIBREAS. Library Ideas
Die Bibliothek als Sackgasse. Zum Berufsbild, wie es Yahoo!-Education sieht.
Ein Kommentar von Ben Kaden / @bkaden
Die Sterne für den Bibliotheksberuf stehen schlecht. Jedenfalls wenn man der Arbeitsmarktastrologie des Education-Portals von Yahoo! glaubt. Dort wurde in einem – undatierten, offenbar wohl neueren – Artikel der Beruf des Bibliothekars / der Bibliothekarin zu einem von fünf Sackgassen-Jobs erklärt. Das mag für eine neuere Arbeitswelt ganz zutreffend sein, in der es pragmatisch mehr um persönlichen Aufstieg und weniger um Identifikation mit dem jeweiligen Tätigkeitsfeld geht und in der man passend von Jobs und nicht Professions schreibt. Wie jeder weiß, ist der Unterschied zwischen beiden Konzepten erheblich. Die Profession bezieht sich auf die Ausbildung, die Qualifikation und eigentlich auch die Identifikation mit einem bestimmten Zuschnitt von Arbeit. Also:
Profession […] a vocation requiring knowledge of some department of learning or science. (dictionary.com)
Ein Job bezieht sich wahlweise auf die konkrete Anstellung oder die konkrete Tätigkeit und lässt den Qualifikationsaspekt irgendwo im Dunklen:
Job […] a piece of work, especially a specific task done as part of the routine of one’s occupation or for an agreed price (dictionary.com)
Geht es bei der Profession um eine individuelle Einstellung zur Sache, spielen beim Job die konkreten Arbeitsabläufe, die individuelle Einstellung als Sache und offensichtlich auch der Preis dafür eine Rolle.
Die NGram-Analyse im Google-Books-Korpus offenbart eine steile Karriere des Wortes „job“ und ein Feststecken bzw. leichtes Absinken der Verwendung des Wortes „profession“. Besonders aussagekräftig ist der Kurvenvergleich jedoch nur dahingehend, dass er zeigt, wie seit dem frühen 20. Jahrhundert sehr gern und oft der Ausdruck Job verwendet wird. In welchem Kontext müsste man jetzt inhaltlich durchdringen.
Die Yahoo!-Autorin Andrea Duchon bewegt sich in ihrer Wortwahl vermutlich auch nicht allzu tief in der semantischen Differenzierung der Konzepte sondern mehr im Zeitgeist des einfachen und klaren Schlagworts bzw. noch wahrscheinlicher in der Bedeutung: Anstellungsverhältnisse. Ein Indikator dafür ist, dass sich die kleine Passage exakt so liest, wie Welterklärungstexte für Dummies gemeinhin verfasst sind:
„Librarians probably play a huge part in your childhood memories, but with a U.S. Department of Labor-projected job growth rate of only 7 percent from 2010 to 2020, it’s likely that „memory“ could be the only role left for librarians to play.“
Andrea Duchon eröffnet mit einer Nostalgisierung und bestimmt damit bereits die Rolle, die ihrer Meinung nach für die Bibliothekare bleibt. Denn die Wachstumsrate bei den Stellen beträgt nur sieben Prozent, wobei unklar bleibt, wie rasant eigentlich ein Stellenangebot wachsen muss, um zur Skyway-Job zu werden.
Sie beruft sich nachfolgend auf die Prognosekompetenz der Karriereberaterin Wendy Nolin, die eine aufbruchsfreudige Firma namens Change Agent Careers betreibt. In aller Offenheit beschreibt diese auf ihrer Webseite ihren eigenen Ausbruch aus einem „Career Spin Cycle“ und das sollte man schon einmal lesen, um einschätzen zu können, vor welchem Hintergrund die Aussagen zum an die Wand laufenden Bibliothekarsberuf getroffen werden.
Why Avoid It: Nolin says that this is a dying occupation simply because information now is so readily devoured using technology.
Hier findet sich fast erwartbar das reduktionistische Verständnis der Rolle von Bibliotheken, wie es unlängst ähnlich von Kathrin Passig in die Debatte katapultiert wurde. Bibliothek und Bibliotheksarbeit wird dabei mit Informationsversorgung gleichgesetzt. Allerdings war bereits das Aufkommen des Dokumentationswesens ein Schritt, der die Bibliotheken hinsichtlich dieser Rolle methodisch und technologisch ziemlich altbacken aussehen lies. Interessanterweise, aber eigentlich folgerichtig, ist dieses Praxis weitgehend in anderen Praxen aufgegangen oder – wie klanglos wie ihr Weltverband, die International Federation for Information and Documentation (FID) – verschwunden, während die Bibliotheken nach wie vor trotz allem auf recht hohem Niveau existieren.
Alarmierender ist dagegen die zweite Aussage Wendy Nolins:
„Plus, she says that federal funding for new libraries is basically non-existent, and job growth is expected to follow suit.“
Verfolgt man die Diskurse zur Zukunft des Bibliothekswesens in den USA, dann bekommt man wirklich den Eindruck, das Public-Library-System befände sich in der Krise. Noch vor 15 Jahren schien es undenkbar, dass im Mutterland des öffentlichen Bibliothekswesens Einrichtungen gekürzt oder geschlossen werden. (Man beachte das zur Schau gestellte Selbstbewusstsein der ALA auf diesen Postern.) Zu diesem Zeitpunkt galt das Bibliothekswesen der USA als Vorbild, Vorreiter und Garten Eden. Jedenfalls im deutschen Bibliothekswesen, dem man Ende der 1990er Jahre dann auch noch seinen zentralen Think-Tank, das DBI, geschlossen hat. Ein Schließungsgrund, den die Gutachter des Wissenschaftsrates peinlicherweise ins Spiel brachten, war die „zu intensive Betreuung der Öffentlichen Bibliotheken“ (vgl. hier). Dieses Beispiel bringt noch einmal in Erinnerung, dass Finanzierungsentscheidungen nicht immer aus überzeugenden oder sogar objektiv tragbaren Einschätzungen heraus gefällt werden. Sondern häufig schwer durchschaubar einmal so oder so ausfallen und nicht selten abhängig davon sind, wer gerade für solche Entscheidungen zeichnungsberechtigt ist.
Erfahrungsgemäß sind ein bereitwilliges Aufspringen auf „Trending Topics“ und das eifrige Klammern an das jeweilige Vokabular der Zeit bestenfalls kurzfristig hilfreich, um die eigene Position bündig zu vermitteln und die entscheidungsbefugten Kürzer oder Förderer zu beeindrucken. Oft zeigt sich dagegen darin nur, dass man mit Mühe den Trends der Anderen hinterhastet, wo an eigentlich eigene setzen sollte. Die interessante Entwicklungskurve des Konzeptes der so genannten Bibliothek 2.0 enthält dafür eine ganze Reihe von Beispielen. Mit der aktuellen Argumentation von Wendy Nolin, Kathrin Passig und anderen, die die Bibliothek als Papierverleihhaus für obsolet und die Arbeit in der Bibliothek zwangsläufig als berufliche Sackgasse deklarieren, irrlichtert man sogar in die Zeit vor 2003 zurück. Dabei liegt aber eigentlich das Kerngeschäft der Bibliotheken just in der Interaktivität, in der grundsätzlichen Remix-Praxis, die sich sowohl durch das Kuratieren wie auch das Rezipieren von Inhalten in der Bibliothek vollzieht und schließlich in dem Aspekt der Kommunikation und Wissensbildung, was weit über das Abrufen von Fakten und Information hinausgeht. Wäre man nicht unbedingt so radikal den Verheißungskünstlern des Library-2.0-Marktes hinterhergeeilt, sondern hätte in Rekurs auf diesen schon vor dem Medium Weblog existierenden Anspruch, dass eine Bibliothek mehr als ein Datenbank-Analogon sein muss, ernst genommen, stände die Bibliothek heute vielleicht noch ganz anders da. Und auch der Diskurs nach innen, der häufig an Mentalitätsklippen brach, die den Eindruck vermittelten, manche Bibliothekare sehnten sich in die klösterliche Übersichtlichkeit der Kettenbuchbänke zurück, wäre womöglich ein Stück weit produktiver verlaufen.
Wenn Förderer, Karriereberater, Netzaktivisten und Publizisten dieses prinzipielle Mehr-als-Information nicht sehen, liegt das Versäumnis indes nicht unbedingt nur bei ihnen (den Vorwurf des Kurzschlussfolgerung müssen sie dennoch aushalten). Sondern auch beim Bibliothekswesen selbst, das sich viel zu oft anstandslos in Buzzwordfeuerwerken, durchsichtigem Techno-Mimikry und öffentlich präsentierten Selbstzweifeln wälzt. Vielleicht zeigt sich darin zugleich auch ein anderes Problem, das uns wieder zur Yahoo!-Berufsanalyse zurückführt: Die Menschen, die in das Bibliothekswesen streben, sind seit je eher nicht die strahlkräftigen, kampfeslustigen und ehrgeizigen Karrieristen. Sondern häufig sympathische, idealistische und bescheidene Personen, die unerschütterlich daran glauben, dass schon gut ist, was sie machen und entsprechend wertgeschätzt wird. (Ein paar karrierebesessene Quertreiber und Egozentriker entdeckt man freilich auch. Die wechseln allerdings meist so schnell sie können auf die Seite des Geschäfts, auf der man deutlich mehr verdienen kann. Und dann gibt es selbstverständlich noch die Verbitterten, die eigentlich etwas Anderes in ihrem Leben machen wollten, aber vom Schicksal im Restraum Bibliothek geparkt und niemals wieder abgeholt wurden. Dies sind gemeinhin die schwierigsten Fälle.) Entsprechend sind die Bibliotheken natürlich ein vergleichsweise leichtes Ziel nicht zuletzt dann, wenn es um Ressourcenverteilungen bzw. -kürzungen geht. Was dem Bibliothekswesen aus meiner Sicht tatsächlich und mehr als technisches Know-How fehlt, ist eine Kultur des sowohl soliden als auch souveränen Widerspruchs. Eben weil die Akteure dieses Berufsfelds in der Regel gar nicht so viel Wert auf rasante Karrierekurven legen, für die gefälliges Verhalten erforderlich ist, könnten sie doch eigentlich weitaus risikofreudiger nach außen gehen, wagen und am Ende vielleicht sogar etwas gewinnen.
(Berlin, 09.12.2013)
Über Kathrin Passigs Bibliotheksbild und was wir daraus lernen können.
Ein Kommentar von Ben Kaden / @bkaden
Kathrin Passig wird offensichtlich gern und regelmäßig als Impulsgeberin zur Diskussionen über die Zukunft der Bibliotheken eingeladen, vielleicht gerade, weil sie von sich zu berichten weiß: „Ich bin nicht so vertraut mit den internen Diskussionen der Bibliotheksbranche.“
Aktuell berichtet sie in ihrer Kolumne für die ZEIT von einer offenbar für sie wenig erfreulichen Konversation mit Frank Simon-Ritz, Bibliotheksdirektor und Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbands. Die Veranstaltung lief unter der wohl alliterarisierend gemeinten Überschrift Apps und Auratisierung: Ein Gespräch zur Zukunft der Bibliothek und anscheinend, wie häufig bei solchen Sitzungen auf Messepodien, ziemlich ins Leere.
Allerdings wurde ich leider nicht Zeuge dieser Dreiviertelstunde, da ich meinen Wochenbedarf an Prognosediskussion bereits weitgehend in meiner eigenen Diskussionsrunde zum Social Reading gestillt hatte, die ebenfalls, vorsichtig formuliert, eher ergebnisoffen endete.
Lieber überzeugte ich mich etwa zeitgleich in den Hallen davon, dass Print wenigstens als Printmarkt so agil wie selten zuvor ist. Es erstaunt im Herbst 2013 tatsächlich, in welcher materialen und handwerklichen Güte auch Parallelausgaben zu den E-Books, deren Absatz mittlerweile sogar im Mutterland des elektronischen Lesens seine Sättigung erreicht zu haben scheint, in Deutschland produziert ver- und gekauft werden. Belege dafür, dass Kathrin Passigs bereits an anderer Stelle gezeigte Papierfeindlichkeit ansteckend ist, fanden sich keine. Auch die Hysterie der Verlagswelt angesichts des Über-Mediums E-Book scheint nicht mehr akut, seit sie gemerkt haben, dass Hardcover trotz allem ganz gut geht, besonders, wenn man sich beim Einband und Satzbild mal etwas einfallen lässt.
Aber vielleicht ist es ja auch eine Ausnahmeort und man trifft dort ohnehin nur Leute, die besonders druckaffin sind, so wie man in einer Bibliothek meist eben nur Bibliotheksnutzer trifft. Das sind in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland wahrscheinlich irgendetwas um die 30 Prozent der Gesamtbevölkerung, was aus meiner Sicht kein allzu niedriger Wert ist. Aber wahrscheinlich keiner, der in Kathrin Passigs digitalen Paralleluniversium allzu bedeutsam wäre:
„Es ist schön, dass es öffentliche Orte gibt, die so vielfältige Nutzungsmöglichkeiten eröffnen wie Bibliotheken, ohne dass man im Gegenzug auch nur einen Kaffee bestellen müsste. Aber in einem Paralleluniversum, in dem öffentliche Bibliotheken nie eingeführt worden sind, dürfte es heute schwerfallen, plausible Gründe für die Einführung solcher Einrichtungen zu benennen. Dass gerade allenthalben prestigeträchtige Megabibliotheken neu gebaut werden, ist kein Gegenargument, denn dahinter stehen etablierte Argumentations- und Finanzierungsstrukturen. Die Steuerzahler des Paralleluniversums würden fragen, ob man nicht stattdessen direkt Coworkingspaces, Veranstaltungsorte, Digitalisierungsprojekte oder eine private Internet-Grundversorgung für Bedürftige fördern und die großen Gebäude mit dem Papier weglassen könnte.“
Nun ist es sehr schwer, mit der abstrakten Pflaume „die Steuerzahler des Paralleluniversums … würden fragen“ argumentativ zu spekulieren. Denn die Steuerzahler sind schon in unserem Universum ein ziemlich heterogener Haufen. Obendrein dürfte die Größe „Steuerzahler“ anders als beim Großflughafen BER, beim Thema Bibliotheken vom eingefleischten Bibliothekshasser bis zum spendablen Bibliotheksliebhaber alle Schattierungen dessen aufweisen, wie man zu solchen Themen stehen kann. In einem Paralleluniversum mag das anders sein. Aber möglicherweise käme man in diesem auf die kuriose Idee, die Co-Workingspaces und öffentlichen Veranstaltungsorte mit Räumen zu flankieren, in denen ein Zugang zu Medien möglich ist.
II
Ernster als die aus irgendeinem persönlichen Anstoß resultierende Abneigung gegen Papier ist in Kathrin Passigs Kolumne die Kritik an der häufig tatsächlich zu beobachtenden Hilflosigkeit bibliothekarischer Selbstlegitimationsversuche zu bewerten. Es ist natürlich grotesk, dass sich eine Institution mit ziemlich guten Durchsatz (etwa 470 Millionen verliehene Medien / Jahr) überhaupt permanent als bedeutsam präsentieren und rechtfertigen muss. Es ist sicher fürchterlich erschöpfend, wenn man dies ständig zudem gegenüber Kleinkämmerer, Papierfeinde und Digitalideologen zu tun verpflichtet ist Aber dies ist wohl die Realität. Vielleicht würde der kritische Steuerzahler eines Paralleluniversums aber fragen, wie teuer die Volkswirtschaft eigentlich die in permanente Evaluation und stetiges Reporting eingebundenen Ressourcen zu stehen kommt.
Kathrin Passig geht es jedoch, so glaube ich, gar nicht so sehr um die Kostenrechnung. Möglicherweise hat sie einfach Freude daran, die Bibliotheken zu necken, in dem sie in den renommiertesten Medien des Landes verkündet, dass die Bibliotheken „kaum noch eine Existenzberechtigung“ haben, wenn sie sich nicht bald wandeln. Das wenig spezifizierte „Wohin“ ist in diesem bekannten Schwarzmalbild vermutlich irgendeine digitale Form. Interessanter ist allerdings das „Warum“ und zwar das Warum in der Frage, warum sich Kathrin Passig so eifrig auf das Thema stürzt. Offen gesagt erscheint mir die Vehemenz, mit der sie stabil und seit Jahren für eine Welt in E-Only missioniert, schwer nachvollziehbar. Von mir aus mag sie sogar Recht haben. Aber warum muss man 2013 noch so kämpfen, als stände man noch immer den bornierten Fortschrittsverweigerern des Jahres 1997 gegenüber, denen die Virtualität digitaler Kommunikation in keiner Form greifbar wird und die deshalb alles ablehnen, was binär anmutet. (So etwas gab es auch in Bibliotheken in dieser Zeit und die wahren Helden sind die Enthusiasten, die in zermürbenden Diskussionen abseits der Öffentlichkeit für ein freies W-Lan im Lesesaal und ähnliche Innovationen stritten.) Auf mich jedenfalls, der ich Vielfalt, Offenheit und die gleichzeitige Existenz von mehr als einer Wahrheit gerade durch Aufenthalte in Bibliotheken, die wunderschön all die Irrtümer und Glaubenskämpfe der Menschheitsgeschichte nachvollziehbar vorhalten, kennen lernen durfte, wirkt diese Selbstüberhöhung mit heftig artikulierten Anspruch auf Deutungshoheit irgendeiner Zukunft nicht wenig unzeitgemäß. Aber vielleicht bin ich es ja auch selbst.
III
Wenn es um die Alltagslegitimation der Bibliotheken geht, die eigentlich ein wenig mehr umfasst, als die Frage, wie digital die Bibliothek der Gegenwart mit ihren Diensten sein will, stehen die handelnden Akteure natürlich unter dem Zwang der Machtstrukturen. Es erklärt aber dennoch nicht, warum man sich auf dem enthobenen Parkett der Buchmesse wieder auf die völlig zu Recht kritisierte und objektiv hanebüchene Argumentationslinie, die (physische) Bibliothek sei doch irgendwie besser als das Internet, einlässt. Sie ist es nicht und wo sie es behauptet, hat sie bereits verloren. Jedenfalls wenn es um Information und Informationsversorgung geht. (Das Bildungsargument greift dagegen nur bei denjenigen, die auch denken, dass MOOCs die Universität als Begegnungsort ersetzen können – ich bin gespannt wann, immer unter dem Argument des Sparenmüssens, die Debatte um die Notwendigkeit der Universität als Ort ausbricht…)
Digitaltechnologie eignet sich fraglos hervorragend für eine bestimmte Art der Informationsnutzung, auch für eine bestimmte Art der Serendipity sowie für eine bestimmte Art der Kommunikation. Mutmaßlich niemand in der Wissenschaft möchte heute bei der Recherche auf die Volltextsuche oder multidimensionales Browsing verzichten. Ich kann ohne Probleme in einer Stunde eine Anzahl von Publikationen einem Screening unterziehen und meist als irrelevant aussortieren, für die ich in vordigitaler Zeit wahrscheinlich zwei Wochen allein zur Beschaffung gebraucht hätte. Das Internet bietet uns die die beste und umfänglichste Informationsinfrastruktur, die die Menschheit für explizite Informationsprozesse jemals hatte. Die digitalen Sozialen Netzwerke schaffen es sogar, unser Sozialleben in maschinenlesbare Information zu verwandeln, in Graphen zu visualisieren und uns in einen permanenten Prozess der Selbstoptimierung zu führen – jedenfalls wenn wir wollen. Die Frage ist nun, ob wir es wollen.
Meine Erfahrungswerte mit Menschen verschiedenster Couleur ist, dass den meisten diese Debatten auch um das E-Book oder das Printbook herzlich egal sind. Viele verstehen die Debatte überhaupt nicht. Die Trägheit der Käufer ist sicher genauso ein Hemmschuh auf der Rutschbahn von Kathrin Passigs These eines „Untergang alles Papierenen“ wie die Hipster-Entscheidung, E-Reader, Smartphone und Buch gleichberechtigt neben dem Bett liegen zu haben.
Mir wird nicht klar, was Kathrin Passig als Argument gegen Bibliotheken vorschwebt, wenn sie schreibt:
„Bibliotheken sind dann niedrigschwellig, wenn man in ihrer Nähe wohnt, nicht in seiner Mobilität eingeschränkt ist, lesen kann, generell damit vertraut gemacht worden ist, dass eine Bibliothek nicht beißt und sich in einem Umfeld bewegt, in dem das Aufsuchen solcher Orte nicht als albern gilt.“
Im Umkehrschluß bedeutet dies nämlich, dass die Bibliothek für den überwiegenden Teil der Menschen in Deutschland mehr oder weniger niedrigschwellig ist. Für alle anderen gab es einmal so etwas wie Soziale Bibliotheksarbeit. Warum also ausgerechnet die Digitaltechnologie für die Masse niedrigschwelliger sein soll, erklärt sie eigentlich auch nicht, wo sie meint:
„Das Internet ist dann niedrigschwellig, wenn man Zugang zu einem internetfähigen Gerät hat und nicht glaubt, dass das Internet seine Nutzer ausraubt und verdirbt. „
Jedoch ist der Zugang genau genommen nicht zum „symbolischen Preis“, wie es in Kathrin Passigs Welt der Fall ist, zu haben, sondern kostet schnell dreißig bis fünfzig Euro im Monat (+ Hardware), was für viele Menschen schwerer zu stemmen ist, als die Busfahrkarte zur Stadt- oder Universitätsbibliothek, in der man bei guter Führung auch ohne Gebühr den Freihandbereich benutzen darf. Allerdings hat die Digitalwirtschaft seit je diese Zielgruppen nicht im Blick. Insgesamt blendet Kathrin Passig in ihrer Frankfurter Kolumne aus, dass das Internet wie wir es heute kennen, vor allem ein Wirtschaftsraum ist, in dem vielleicht noch ein paar Nischen des offenen Webs der 1990er übrig sind, dass generell aber keine Schnittmenge mit dem im Kern nach wie vor am Gemeinwohl orientierten Grundversorgungsauftrag öffentlicher Bibliotheken besitzt. Das letztere diese besondere Rolle für die Gesellschaft häufig selbst kaum mehr reflektieren und das Thema auch nirgends auf der Agenda der Fachkommunikation auftaucht, macht die Sache natürlich nicht besser. „Apps und Aura“ haben naturgemäß mehr Sexappeal und sind auf dem Jahrmarkt Buchmesse zwischen Wolfgang Joop und Boris Becker bestimmt am richtigen Ort. Der Bibliotheksalltag sollte aber vielschichtiger sein. Und er ist es auch.
IV
Für die saturierte Mittelschicht, aus der sich die bundesrepublikanische Bevölkerung nach wie vor weithin zusammenfügt, dürften fünfzig Euro Zugangskosten im Monat vielleicht kein symbolischer aber doch ein überschaubarer Preis sein. Entsprechend ist es mittlerweile für weite Teile der Gesellschaft so normal, ein Touchscreen-Telefon zu haben, wie man im Bad einen Wasserhahn erwartet. Und natürlich liest man permanent auf den Displays, nämlich die Social-Media-Streams und ab und an eine Kolumne auf ZEIT online. Der einstige Statusgewinn, denn man mit solcher Technologie erzielen konnte, ist dagegen mittlerweile weitgehend verloren. Sie sind inzwischen Werkzeuge und darin für die meisten so faszinierend wie eine Elektrolokomotive. Alle anderen lesen, je nach Präferenz, das LOK Magazin oder Macworld.
Überraschend ist, dass das Vorhandensein heimischer Breitbandzugänge ebenso wenig wie frühere Medienkonkurrenten so viele Menschen nicht davon abhält, doch ab und an in die Bibliothek zu gehen. (Oder eine Computerzeitschrift in der Papierausgabe zu kaufen.) In Universitätsbibliotheken sind es häufig sogar ein bisschen zu viele. Will man also die Bibliothek und ihre Attraktivität beleuchten, braucht man eigentlich nur fragen, warum sie in die „Papiermuseen“ (Kathrin Passig) streben. Dann weiß man auch, was man an Eigenschaften erhalten muss, damit sie wieder kommen.
Man muss sich, so denke ich, aus Sicht der Bibliotheken gar nicht so sehr in dieses Binärschema der Diskursmühle einspannen lassen, das eine kleine Gruppe von Menschen, die bestimmte Technologien lieb(t)en und durchsetzen woll(t)en, in ihrem digitalen Revolutionskampf bis zur Mainstreamifizierung der re:publica entwickelten und heute auch bereits aus Tradition weiterpflegen und dessen Kern lautet: Entweder wir oder ihr. Aber besser wir.
Es geht hier nicht darum, wer Recht hat oder sich durchsetzt. So laut und wichtig die Stimme von Kathrin Passig ist – sie wird nicht maßgeblich darüber entscheiden, wie die Menschen lesen. Denn die meisten Menschen lesen nicht einmal sie. Wir tun es und zwar gern und hoffen auf Anregung. Es ist richtig, solch radikale und wie die meisten radikalen Positionen, anscheinend nur bedingt auf Eigenaktualisierung und Dauerreflexion gerichteten Ansätze, zur Kenntnis zu nehmen. Man sollte sich nur nicht von ihren Prognosen verrückt machen lassen. Zumal Kathrin Passig selbst einmal sagte:
„Ich glaube nicht, dass es das Qualitätskriterium für einen Gedanken ist, dass er auch in 300 Jahren noch richtig sein muss. Ich glaube, man kann sehr gute Ideen haben, die genau von jetzt bis nächsten Sommer richtig sind und danach nicht mehr. „
Derzeit jedenfalls blühen wenigstens im Publikationsbereich beide Kulturen, die des Materials und die des Digitalen, ganz gedeihlich miteinander.
V
Ein Hauptdefizit der Diskussion ist schließlich, wie sich die Vertreter des Bibliothekswesens auf den Aspekt, etwas besser oder billiger vermitteln zu können (oder müssen), festnageln lassen. Denn darum geht es in Bibliotheken idealerweise nur sehr am Rand. Bibliotheken sind, wie das Internet auch, Räume der Möglichkeit, jedoch im besten Fall nicht von Markt- und Renditeerwartungen getrieben. Sie stehen daher auch außer Konkurrenz. Die Einführung betriebswirtschaftlicher Radikalkuren in das Bibliothekswesen brachte zwar einigen Beratern und einer Handvoll Akteuren aus der Bibliotheksbranche ein bisschen was, gab dem Bibliothekswesen selbst jedoch weniger Impulse, die es wirklich verwerten konnte. Wer hart kalkulieren und jede Ausgabe begründen muss, wird eben nicht flexibler und kann auch nicht gut experimentieren – also genau die Fertigkeiten entwickeln, die der Digitalkultur (und der Digitalwirtschaft) einst die entscheidenden Schübe gaben. Was das Bibliothekswesen wahrscheinlich viel stärker als eine vermeintliche Liebe zum Papier hemmt, ist die Kombination von umfassender Abrechnungsbürokratie und absoluter Zeitgeistigkeitserwartung.
Das Bibliotheken sich gerade nicht rechnen müssen, ist (war?) übrigens ein zentrales Argument für diese Einrichtungen und ihre Rolle in einer auf Inklusion gerichteten Gesellschaft, was unbedingt einschließt, dass sie einen solchen freien und offenen Raum auch so weit wie möglich in das Internet ausdehnen. Wer kann wirklich abschätzen, welche Effekte konkrete Erfahrungen mit öffentlichen (digitalen) Bibliotheken auf welchen ihrer Nutzer und mit welcher Langzeitwirkung haben? Es gibt zwar immer ein paar gesellschaftliche Leuchtturmfiguren, die als Kinder gern in Bibliotheken herumstöberten und darin die Grundlage ihres kulturellen Aufstiegs sehen. Es gibt zugleich genügend Erfolgsgeschichten in jungen Jahren sozial marginalisierter Outsider, die aus der Garage jeweils eine Technologie in die Welt brachten, der sich auf einmal ein Großteil der informationell engagierten Welt unterwerfen wollten. Beides ist nicht sehr repräsentativ.
Es existieren nämlich Millionen von ehemaligen Bibliotheksnutzern, die irgendwann ein ganz überschaubares Leben als Berufskraftfahrer oder Sachbearbeiter führten. Und zehntausende Nerds, die nicht zu Milliardären wurden, sondern als Brotprogrammierer Verkaufsplattformen am Laufen halten. Wahrscheinlich wollen die wenigstens Menschen Teil einer Wissenschaftsgesellschaft sein, in der sie ständig gehalten sind, informationelle Höchstleistungen zu erbringen. Sondern einen handhabbaren Lebensalltag. Ihnen gefällt vielleicht gerade das begrenzte Maß an Serendipity, das eine Freihandaufstellung oder sogar ihr Regal zuhause bereithält. Vielleicht mögen sie also Bibliotheken vor allem dann, wenn sie sich dort irgendwie ihren Bedürfnissen gemäß mit Medien oder auch nur der Kontemplation auseinander setzen können und nicht, wenn ihnen permanent Bildungs- und Aufstiegs- und Aktivitätsnotwendigkeiten aufgedrängt werden. Bibliotheken sollten wahrscheinlich beide Dimensionen, die Streuung und die Konzentration anbieten. Nicht selten tun sie es de facto auch. Dass man zur Konzentration im Internet schwer ein Gegenstück im WWW findet, wäre mir allerdings als Argument in der Auseinandersetzung, wer was besser kann, der Apfel Internet oder die Birne Bibliothek, ein bisschen zu preiswert.
Interessanter sind für mich nämlich zwei damit zusammenhängende Grundfehler, die ich in der Debatte erkenne. Einerseits modelliert man in der Regel einen auf ein sehr aktives und bewusstes Informations- und Rezeptionsverhalten ausgerichteten Menschen als Ideal. Man geht davon aus, dass der Mensche immer mehr Wissen will, quantifiziert also seine Bedürfnisse in einer vergleichsweise schlichten Form. In Bezug auf Kinderbibliotheken und Informationskompetenz strebt man bisweilen danach, genau solche Informations-Poweruser heranzuziehen. Andererseits stellt man immer den Anspruch einer Optimierung, nach technischer Höchstleistung und maximalem Durchsatz. Man reproduziert demnach Muster der Leistungsgesellschaft in eine Sphäre, in der diese gar nicht notwendig wären, eventuell sogar schädlich sind.
Obendrein betreffen beide Aspekte nur ganz bestimmte Milieus und angesichts der kognitiven Investitionen und den erstaunlicherweise nicht weniger sondern meist nur komplexer werdenden Entscheidungen, die ein Mensch in solchen Kontexten zu treffen hat, sind diese als Zielpunkte des Lebens nur noch mäßig attraktiv. Dadurch, dass fast jeder jederzeit Zugriff zu Unmassen von Daten, Informationen und Inhalten hat, wird dieser Zugang banal und die Verpflichtung zur Teilhabe an der informationellen Entfaltung fast zur Last geworden. Die großen Luxushotels dieser Tage integrieren fast alle einen Bibliotheksraum. Keines jedoch einen Computerpool. Es ist heute ein Kennzeichen der Elite, nicht permanent netzvermittelte Informationen verarbeiten zu müssen. Und ein wenig scheint mir, als sickere dieser Abstinenzgedanke schon wieder in andere soziale Schichten durch.
VI
Ich bin mir nicht sicher, ob wir bereits den Einstieg in ein postdigitale Kultur erleben, in der die digitale Vernetzung so nebenher läuft, wie es vor fünfundzwanzig Jahren das Radio und das Telefon taten. Digitale Informationsräume sind Teil der Infrastruktur, auf die wir permanent zurückgreifen, wenn wir einen Bedarf haben. Ansonsten, so vermute ich, sind die Menschen in Zukunft gar nicht unglücklich, wenn sie sie nicht mehr wahrnehmen. Die Google-Brille ist übrigens ein konkreter Schritt in dieser Richtung. Digitale Kommunikationsmedien sind damit aber völlig normal und damit auch grundsätzlich in die Bibliotheken integriert, denn die Nutzer tragen sie ja bereits am Körper.
Die Bibliotheken haben aber damit selbst wenig zu tun. Menschen, wenigstens die aus den Schichten vom Mittelstand aufwärts, gehen nicht in die Bibliothek, weil es keine Alternativen gäbe, mit denen sie ihr Informations- oder Unterhaltungsbedürfnis ansprechen und bedienen können. Sie gehen in die Bibliothek, weil bzw. wenn diese ihnen die für ihren Geschmack und ihre Stimmung passende Form anbieten. Es ist kurioserweise eine Konsumentscheidung – wie der Kauf von Zahnpaste, bei dem der konsumhedonistische Großstädter mal Dentagard, mal Aronal, mal Marvis ins Bad stellt, mal einen Film im Online-Streaming und ein anderes Mal im Kino ansieht oder heute zu Curry 36 und morgen ins Grill Royal maschiert. Dank Internetzugang und e-Commerce sind wir für alles, was digital oder im Postpaket transportabel ist, überall in Deutschland potentiell konsumhedonistische Großstädter. In jedem Fall haben wir eine Vielzahl von Optionen.
Das gilt genauso für das gedruckte Buch. Wir leben in der luxuriösen Situation, dass wir oft wählen können, in welcher Form wir einen Text lesen wollen. Wenn man sich heute die gebundene Ausgabe entscheidet, dann einfach, weil man es möchte. Solange sich diese Entscheidungen zu einem Volumen addieren, das einen Absatzmarkt mit nur minimaler Marge ergibt, wird es höchstwahrscheinlich jemanden geben, der diesen Markt auch bedient. Wer beobacht hat, was Menschen auf sich nahmen, um das furchtbar unbequeme und anachronistische Medium des Polaroid-Films nach der Einstellung der Produktion am Leben zu halten (und zwar mit Erfolg), den wird nicht überraschen, dass es außerhalb unserer kleinen fachbibliothekarischen und feuilletonistischen Diskurszirkel Millionen von Menschen gibt, die nicht aus Nutzenrationalität handeln und deshalb danach fragen, was die Bibliothek oder das Internet besser können. Sondern einfach tun, worauf sie gerade Lust haben. Daher lohnt es sich mittlerweile offenbar auch wieder, Hörbücher auf Schallplatten zu veröffentlichen.
Bei aller Liebe zum haptischen Appeal des Apple-versums. Wenn es um die Lust und also um ein erotisches Moment (in der Bedeutung von Sinnlichkeit) geht, dann haben die Bibliotheken einige Dimensionen mehr zur Verfügung als die Displays, die für die Digitalkultur wahrscheinlich auch nur eine Zwischenlösung darstellen. Da die Nutzer ohnehin ihre Tablets oder Smartphones mitbringen, reicht es fast, die Versorgung mit W-Lan und Lade-Docks sicherzustellen. Und vielleicht eine Handvoll Tablets in Reserve zu halten, falls jemand keines mitbringt. Und eine App als Marketinginstrument. So etwas mag nicht die edelste Strategie sein, an der man Bibliotheksentwicklungen ausrichten kann. Aber sie als über-funktionale, sinnliche Erlebnisräume für alle zu denken, kann sie womöglich derzeit viel zeitgemäßer und, auch das, auratischer wirken lassen, als es die ein- und abgeschliffenen Argumente aus dem Strahlenkreis der Informationsversorgung vermögen. Nebenbei könnte man dann in aller Ruhe beginnen, die eigentliche gesellschaftliche Rolle einer Bibliothek neu zu bestimmen.
04.11.2013
Aufmunterer. Brauchen wir ihn?
Von Karsten Schuldt
Zu: Janes, Joseph (edit.) / Library 2020 : Today’s Leading Visionaries Describe Tomorrow’s Library. Lanham ; Toronto ; Plymouth, UK : The Scarecrow Press, 2013.
Vielleicht benötigt das Bibliothekswesen an sich Bücher und Zeitschriften-Schwerpunkte, die fragen, wie die Zukunft sein wird. Nicht unbedingt, um wirklich die Zukunft der Bibliotheken zu eruieren, sondern als eine Art Spielwiese, auf der (a) sich gegenseitig versichert werden kann, dass die Bibliotheken auch in Zukunft wichtig sein werden, (b) dass sie sich verändern werden, (c) auf der gleichzeitig ganz unterschiedliche, oft auch widersprüchliche oder kaum ernstzunehmende, Zukunftsperspektiven gezeichnet werden können und wo (d) sich die Möglichkeit bietet, sich über bestimmte Entwicklungen aufzuregen. Zu vermuten ist, dass die Bedeutung von (a) zu (d) abnimmt, auch ist in einigen solcher Sammlung gerade der Punkt (d) ausgelassen. (Vielleicht aus Angst, das jemand von ausserhalb des Bibliothekswesens diese Sammlung lesen und ein schlechtes Bild gewinnen könnte.) Zudem fehlt praktisch immer die Möglichkeit, (e) dass jemand den Status quo gut findet oder ihre / seine Ängste vor den kommenden Änderungen kund tut. Das solche Positionen existieren, tönt regelmässig in den Sammlungen zur Zukunft der Bibliotheken an, aber immer nur als Enemy within, als Angst des vorgeblich entwicklungsunfähigen Personals oder einiger Leitender, die zu überwinden sei.
Zu fragen ist allerdings nach der Funktion dieser Sammlung. Sicherlich: Über die Zukunft nachdenken soll dabei helfen, zu verstehen, welche Voraussetzungen auf Bibliotheken zukommen. Die Moderne hat bekanntlich die Überzeugung in die Welt gesetzt, dass sich ständig alles ändert und ändern muss, um besser zu werden. Kehrseite dieses Diskurses ist, dass, was und wer sich nicht ändert, untergehen würde. Dies scheint gar nicht mehr wirklich begründet werden zu müssen. Unterschiede scheinen eher darin zu bestehen, ob dies ständigen Veränderungen als Bedrohung oder Möglichkeit angesehen oder aber eher als normale Arbeitsgrundlage angenommen werden; allerdings gilt dies nicht nur für das Bibliothekswesen, sondern für unterschiedliche Teile der Gesellschaft.

Zu kritisieren allerdings ist die Layoutwahl des Titels. Als wären farblich die 1970er Jahre wieder gefragt.
Diese Gedanken drängen sich beim Lesen von Library 2020: Today’s Leading Visionaries Describe Tomorrow’s Library auf. Das Buch ist eine Sammlung von 23 kurzen Beiträgen von Personen, die im US-amerikanischen Bibliothekswesen in unterschiedlichen Positionen aktiv sind (in Bibliotheken unterschiedlicher Typen, in der Ausbildung, Forschung oder Beratung). Allen Beiträgen ist gemeinsam, dass sie mit der Aufforderung begannen, den Satz zu vervollständigen: „The library in 2020 will be…“ Im letzten Beitrag gibt dann der Herausgeber – entgegen der Behauptung, es nicht zu tun – eine Zusammenfassung der vorhergehenden Texte.
Erfrischend ist an den Texten, dass in ihnen relativ offen gesprochen wird. Offenbar fühlen sich die Beteiligten unter ihresgleichen. Die Texte, die so erscheinen, als würden sie zu Marketingzwecken von bibliothekarischen Verbänden geschrieben sein und vor allem betonen, wie wichtig Bibliotheken seien, halten sich stark in Grenzen. Einige der Beitragenden versuchen, die gestellte Aufgabe eher spielerisch zu meistern, was nur manchmal erfolgreich ist. Einige Texte argumentieren aus eigener Betroffenheit und führen die eigenen Bibliotheken als Beispiel an – was teilweise auch zu erstaunlichen Aussagen führt, wenn zum Beispiel Ruth Fraklis (Direktor Prairie Trails Public Library District) Bibliotheken als Teil des war on gangs beschreibt –, andere beziehen sich auf einen grösseren Rahmen. Es gibt im Buch zwar eine grobe Unterteilung der Texte in die Bereiche Stuff, People, Community, Place, Leadership and Vision und dies umreisst auch einige wichtige Themenbereiche, die immer wieder angesprochen werden. Zudem tauchen selbstverständlich beständig die Entwicklung digitaler Angebote und technischer Möglichkeiten sowie die Frage, welche Rolle gedruckte Bücher 2020 spielen werden, auf.
Auffällig aus Sicht der deutschsprachigen Bibliothekswesen ist, dass Bildung, welche ein Megathema in den Diskussionen im DACh-Raum darstellt, quasi nicht angesprochen wird. Nur am Rand tauchen Beispiele der Literacy Instruction als bibliothekarische Dienstleistungen auf. Offenbar ist diese Konzentration auf Bildung etwas, dass nicht universell als drängendes Thema des Bibliothekswesens angesehen wird. Ebenso sind Richtlinien, Standards et cetera kein Thema der Beiträge dieses Buches. Vielleicht sind sie so sehr als Bestandteil bibliothekarischer Arbeit akzeptiert, dass über sie einfach nicht gesprochen werden muss – obwohl man über sehr viel anderes spricht –, vielleicht aber scheinen sie auch einfach nicht so wichtig für die Zukunft. Erstaunlich ist, dass die gesamten Debatten um das neue Regelwerk, FRBR und Bibframe sowie um Forschungsdaten praktisch vollständig fehlen.
Davon abgesehen überraschen die einzelnen Texte kaum. Vielmehr scheinen sie das zu antizipieren, was aktuell als zwingend im US-amerikanischen Bibliothekswesens gilt: der Raum Bibliothek muss umgestaltet werden, die einzelnen Bibliotheken müssen sich an ihren Communities vor Ort orientieren (mit Community Engagement in Öffentlichen Bibliotheken und Konzepten wie den Embedded Librarians in Wissenschaftlichen), die Bibliotheken müssen sich selbst immer wieder neue Aufgaben geben und dabei auf die Communities reagieren, das Personal muss flexibel sein und sich beständig mit modernen elektronischen Kommunikationsmitteln auseinandersetzen. Zudem muss die Entwicklung der Bibliotheken strategisch geplant werden. Und es sollte mehr Geeks als Personal in Bibliotheken geben, aber die kommen auch so. Zu guter Letzt: Die Bibliothek wird es auch 2020 geben und irgendwie, wir wissen nicht wie, wird sie aussehen.
Mit diesem Themen fühlt sich das Buch sehr als Produkt der heutigen Zeit an, fast möchte man ihm ein Label wie „Sooooooooo 2012“ anhängen (auch wenn es 2013 erschien, sind die Texte 2012 offenbar geschrieben worden). Es gab im Laufe der Jahrzehnte regelmässig solche Werke zur Zukunft des Bibliothekswesens (worauf in einige Texte des besprochenen Buches auch verwiesen wird), die heute jeweils sehr zeittypisch erscheinen. Dieses Buch scheint einfach das neuste in dieser Tradition zu darzustellen.
Das muss nicht schlecht sein, aber es führt zurück zu der Eingangsfrage: Was ist eigentlich die Aufgabe dieser Publikationen im Bibliothekswesen? Helfen sie wirklich dabei, die Zukunft zu gestalten oder zumindest zu verstehen? Es scheint eher, dass sie Hinweise zur aktuellen Praxis in Bibliotheken geben und der Selbstversicherung der Bibliothekswesen dienen. Wirklich Neues erfährt man in ihnen praktisch nicht. Versteht man sie aber wirklich als Selbstversicherung, zeigt dieses Buch, dass zumindest des US-amerikanische Bibliothekswesen als solches lebendig ist und Debatten führt.
Für die deutschsprachigen Bibliothekswesen ist aus solchen Publikationen zudem eines zu lernen, nämlich das die Debatten, die in und auf den deutschsprachigen Zeitschriften, Mailinglisten, Konferenzen geführt werden, nicht so alternativlos sind, wie sie vielleicht erscheinen. Konkret in diesem Fall (aber es lassen sich je nach Jahr und Fragestellung auch andere Fälle finden): Nur, weil fast alle Öffentlichen und Hochschulbibliotheken im DACh-Raum auf das Thema Bildung setzen und nur, weil in der Community das Forschungsdatenmanagement als wichtiges aktuelles Thema gilt, heisst dies nicht, dass dies weltweit – noch nicht einmal im gesamten globalen Norden – so gesehen wird. Andere Themen können auch diskursbestimmend sein, in den USA scheint es (wie auch in Australien und Neuseeland) zunehmend – wieder – die Konzentration auf die Community, in der die Bibliothek tätig ist, zu sein. Dies soll nicht heissen, dass man den US-amerikanischen Diskussionen folgen müsste. Vielleicht sind in den deutschsprachigen Gesellschaften tatsächlich Bildung und Forschungsdaten das wichtigste Thema für Bibliotheken. Aber es ist doch lehrreich und kann die Diskussionen entspannen, wenn wahrgenommen wird, wie sehr sich die – allesamt sich selber als zukunftsorientiert verstehenden – Debatten in strukturell nicht so sehr differenten Bibliothekswesen entwickeln.
Sollte man also dieses Buch lesen? Wenn man sich ein Wochenende eher entspannt mit Bibliotheken beschäftigen möchte, dann unterhalten diese kurzen Texte sehr wohl. Ansonsten enthält es aber kaum neue Erkenntnisse. Vielleicht kann man es gut als Popcorn-Flick für Bibliotheksinteressierte beschreiben: Unterhaltend, aber nicht nachhaltig nachdenklich machend.
LIBREAS Call for Papers LIBREAS #24: Zukünfte
Update: Wir haben auf mehrfache Bitte den Redaktionsschluss bis zum 14.02.2014. verlängert.
„Der Bibliothekar muß Kritiker und Architekt sein – Zerstörer des Veralteten und Bildner seiner eigenen Zukunft.“ (Stummvoll, 1965, 26)
„So besehen ist die Frage nach der Zukunft der Bibliothek im Kern die Frage nach der Zukunft der Druck- und Schriftkultur.“ (Gradmann, 2005, 99)
„Die Bibliothek des späten 20. Jahrhunderts, wie wir sie kennen, wird uns 2050 nicht mehr begegnen.“ (Kaden, 2006, 43)
Was ist es eigentlich, dieses Verhältnis zwischen Zukunft und Bibliothek? Ist es ein gesundes? Die Zukunft ist, seit die Moderne begonnen hat, immer gleich um die Ecke, immer Bedrohung und Verheißung zugleich, als greifbarer Fortschritt oder als möglichst zu vermeidende Apokalypse. Die Zukunft treibt Entwicklungen, man strebt ihr entgegen oder fürchtet sie. Die Zukunft war die virtuelle Sphäre des Handelns bevor wir dem Cyberspace eine www-codierte Form gaben. Sie ist motiviert aus den Unzulänglichkeiten des Heute, sie ist ein Versprechen, bisweilen auch eine Wette. Und sie ist vor allem: ungewiss und unvermeidlich.
Aus vergangenen Zukünften
Die Deutsche Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen schrieb 1928 auf dem Höhepunkt des Richtungsstreits:
„Die deutsche öffentliche Bücherei steht an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Entwicklung. Große neue sachliche Arbeitsbereiche, mit deren Bewältigung erst die volkstümliche Bücherei ganz zu sich selbst kommen wird, haben sich aus einem dreißigjährigen Arbeitsgang herauskristallisiert, zugleich aber geht die volkstümliche Bücherei im Zusammenhang mit Davesplan und Kulturabbau der Gemeinden, schweren elementaren Existenzkämpfen entgegen. Will sie die sachliche Arbeit ersprießlich leisten und die Existenzkämpfe erfolgreich bestehen, dann bedarf sie in sich selbst eines großen Maßes von Festigkeit und Einheit. Hieran fehlte es in den letzten Jahrzehnten der volksbüchereipolitische Kämpfen […].“ (Deutsche Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen 1928, V)
Die Terminologie ist vielleicht eine andere, die Problemstellung leicht anders (obwohl: es geht um Geld und darum, dass alles schlechter wird), die Empfehlung ist vielleicht etwas anrüchig geworden. Aber die Struktur der Argumentation lässt sich so oft finden, wenn es um die Frage der Zukunft von Bibliotheken geht.
Gleichwohl wissen wir als Bibliothekswesen schon lange, dass es so, wie es vorhergesagt wird, nicht unbedingt kommen wird:
„Wir wissen nicht und können es auch nicht wissen, wie die Bibliothek der Zukunft aussehen wird, Prophezeien ist eine schwere und ungewisse Sache; wir können uns daher mit diesem Problem nur mit einem recht unbestimmten Grad von Wahrscheinlichkeit befassen.“ (Stummvoll 1965, 1)
Nicht zuletzt wissen wir, dass das, was wir heute als drängende Frage stellen, in kurzer Zeit ein veraltetes Thema sein kann. Die Fragestellungen einer bibliothekarischen Konferenz 1977 lauteten zum Beispiel:
”1. First of all, do we want, do we need computerised information services?
2. If so, what kind of service should we have?
3. Where should it be located?
4. What will it cost?
5. Finally, how should it be paid for?“ (Fleming 1977, 3)
Heute haben wir für die meisten dieser Fragen klare Antworten.
Zugleich drängt sich, je länger je mehr, auch ein Verdruss auf, wenn es um die Frage nach der Zukunft der Bibliotheken geht: Wiederholt sich nicht einfach alles immer wieder in leicht verschobener Terminologie? Ist es nicht so, dass eher die Bibliotheken getrieben werden, statt dass sie selber ihre Zukunft bestimmen? Ist die Diskussion um die Zukunft nicht eine zeitlose und lästige Debatte? Sollten wir nicht lieber eine ewig währende Gegenwart annehmen, in der wir uns auf Umweltentwicklungen hin optimieren? Wäre dies nicht der realistischere Weg?

Was von den Gegenwarten bleibt ist bisweilen nur ein Abdruck. Da kann man noch so weiterbildungsbewusst und/oder biegsam sein – und soweit unsere paläo-ichthyologischen Grundkenntnisse reichen, schwärmte dieser Leptolepis sogar einmal in einer Schule (in Mittelfranken). Irgendwann in ferner Zukunft zeigt sich selbst der dickste Fisch des jeweiligen Präsens nur als ein Schatten, wie zufällig auf einer Schiefertafel gehoben. Der Kalkstein ist übrigens tatsächlich nicht nur für ein einschlägiges Jurastudium relevant. Sondern er war auch das Material, das Alois Senefelder für seine Flachdruckplatten nahm. So zeigt sich, dass sowohl die Erdgeschichte seit Ur-Garnelen-Zeiten wie auch die Steindruckkultur seit etwa 1800 aus dem selben Stoff geschnitten sind. Dass die Knochenfische mit einem dezidierten Zukunftsbewusstsein durch ihre Meereswelten schwammen und schwimmen scheint aus menschlicher Sicht unwahrscheinlich. Denn der Mensch hat die Zukunft erfunden und zwar hauptsächlich für sich. Als Konstruktionsmaterial bleiben ihm dafür zwangsläufig nur die Spuren der Vergangenheit. Beziehungsweise die Spuren vergangener Zukünfte. Eine schöne Eigenschaft von bestandsorientierten Bibliotheken (nach manchen Diskursen eine aussterbende Spezies) ist bekanntlich, dass sie diese Spuren (auch für die Zukunft) nachvollziehbar halten. Sie sind mit dieser Eigenschaft das Solnhofen unserer Kulturgeschichte. Beiträge zu dieser Facette von Zukunft in der Bibliothek sind für LIBREAS #24 selbstverständlich hoch willkommen. Vielleicht auch, damit eines Tages die Fachleute der digitalen Archäologie auf einer Partition eines e-doc-Servers auf Spuren von Kopf und Rückgrat stoßen, die einen ganz besonderen Horizont der Geschichtlichkeit der frühen Digitalkultur nachverstehbar machen.
Die Zukunft der Zukunft
Schwierig wird es dann, wenn dies dazu führt, dass sich die Daseinsform selbst auflöst. Man benötigt Distanz, um die eigene Situation, die eigenen Möglichkeiten mit dem eigenen Wunschbild abzugleichen. Alles Konkrete eines Blicks in die Zukunft mag falsch sein. Aber sie gibt uns die Möglichkeit zum distanzierten Blick.
Daher kommen wir um die Zukunft nicht herum. Wir wissen, dass wir nicht wissen können, was morgen sein wird. Aber wir können uns verständigen, was wir morgen sein wollen. Und danach handeln.
Wie wird die Bibliothek der Zukunft sein? Wird in Zukunft noch eine Bibliothek sein oder werden wir von anderen Dingen sprechen? Was wird die Bibliothek beerben? Wird sich überhaupt etwas verändern in naher oder weiter Zukunft? Werden die Bibliothekarinnen und Bibliothekare sich ändern? Welcher Gestaltungsspielraum bleibt? Und wenn, wer wird für die Bibliotheken sprechen? Wollen überhaupt wirklich alle in eine (ähnliche) Zukunft? Und wie entwickelt sich die Spannung in der Gleichzeitigkeit von Innovationsanspruch und dem Luxus (scheinbarer) Anachronismen, die je größer scheint, je größer die Einrichtung ist?
In der Ausgabe # 24 möchte die LIBREAS die Zukunft in die Gegenwart (dieser Ausgabe) holen und ruft deshalb dazu auf, Artikel (oder andere Beiträge) zu den Fragen der Zukunft der Bibliotheken, der Medien und aller damit zusammenhängender Themen, Gebiete und Institutionen einzureichen. Als Fragestellungen drängen sich auf:
- Fragen der erwartbaren Zukunft. Was können wir nach all den vorhergesagten Veränderungen, die dann doch nicht eintrafen und den Veränderungen, die eintraten, ohne dass sie vorhergesagt wurden, tatsächlich über die Zukunft und die Bibliotheken sagen? Was werden ihre Funktionen sein? Was wird das Personal tun? Wie werden die Gebäude aussehen? Wie wird die Bibliothek heißen?
- Wie verstrickt ist die Zukunft der Bibliothek in die Zukunft der Medien-, Kommunikations- und Wissenskulturen?
- Welche Zukünfte sind wünschenswert? Und welche nicht? Ist es sinnvoll, über die Zukunft zu reden, wenn die Gegenwart nicht greifbar ist?
- Wer oder was ist es eigentlich, dass die Zukunft der Bibliotheken bestimmt? Welche Interessen werden umgesetzt? Wieso? Wie? Wie kann man dies unter Umständen verhindern, ändern, fördern?
- Welche Zukünfte prägten die Vergangenheit? Was wünschte man sich, was traf ein, was blieb aus?
- Welche Zukunft haben die Wissenschaften, in denen die Bibliothek, ihre Prozesse, Aufgaben und Rollen analysiert werden? Und wie gestalten diese Bibliotheks-, Informations- und Kulturwissenschaften die Zukunft der Bibliotheken?
- Bibliotheken und Science Fiction. Nicht zuletzt ist auffällig, dass gute Science Fiction so gut wie nie ohne Bibliotheken oder Informationssysteme auskommt. In Solaris trifft Kris Kelvin wichtige Entscheidungen in der Bibliothek, der Anhalter durch die Galaxis ist direkt eine Community Publication und in Star Trek ist der Computer, welcher offensichtlich eine semantische Maschine darstellt, grundlegend wichtig. Wieso eigentlich ist es offenbar so schwierig, sich eine Zukunft ohne Bibliotheken vorzustellen?
Die LIBREAS begrüßt alle Versuche, sich diesen Fragen zu stellen und freut sich auf Einreichungen zum Thema. (Einreichungen zu anderen Themen der Bibliotheks- und Informationswissenschaft und des Bibliothekswesens sind ebenso erwünscht.) Hinweise zur Einreichung finden sich unter http://libreas.eu/authorguides/, Deadline für die Ausgabe # 24 ist der 30.10.2013 14.02.2014.
LIBREAS-Redaktion
(Berlin, Bielefeld, Chur, Mannheim, Potsdam)
Literatur
Deutsche Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen (Hrsg.) (1928) / Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen volkstümlichen Bücherei. – (Schriften zur Büchereifrage). – Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer.
Flemig, M. G. (1977) / Introduction by Professor Fleming, Pro-Rector Imperial College. In: Conference on the Future Role of Computerised Information Services at the University of London : 25 January 1977 ; Proceedings. – London: Resources Co-Ordinating Committee, University of London, S. 5.
Gradmann, Stefan (2005) / Hat die Bibliothekswissenschaft eine Zukunft? In: Hauke, Petra (Hrsg.) Bibliothekswissenschaft – quo vadis? – München: Saur, 2005, S. 96-102.
Kaden, Ben (2006) / Gegenwart, Zukunft und Ende der Bibliothekswissenschaft. In: Hauke, Petra; Umlauf, Konrad (Hrsg.) Vom Wandel der Wissensorganisation im Informationszeitalter. – Bad Honnef: Bock+Herchen, S.29-48.
Stummvoll, Josef (1965) / Die Bibliothek der Zukunft : Automationsprobleme im Bibliothekswesen. – (Biblios-Schriften ; 42). – Wien: Österreiche Nationalbibliothek.
It’s the frei<tag> 2013 Countdown (15): 15 Bücher über Bibliotheken, die noch geschrieben werden müssen
von Karsten Schuldt und Christoph Szepanski
„We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done.“ – Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, Mind, 59, 433-460 (1950)
„Für die ruhigen Leser ist das Buch bestimmt, für Menschen, welche noch nicht in die schwindelnde Hast unseres rollenden Zeitalters hineingerissen sind und noch nicht ein götzendienerisches Vergnügen daran empfinden, wenn sie sich unter seine Räder werfen, für Menschen also, die noch nicht den Wert jedes Dinges nach der Zeitersparnis oder Zeitversäumnis abzuschätzen sich gewöhnt haben. Das heißt – für sehr wenige Menschen.” (Friedrich Nietzsche, Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern. In: derselbe, Werke in drei Bänden. München 1954, Band 3, S. 272f.)
Wer, so wie wir uns, sich schon einmal die Frage gestellt hat, welche Bücher man über die Bibliotheks- und Informationswissenschaft gern im Studium- oder einem späteren Berufsabschnitt gern gelesen hätte (und besonders im Urlaub), aber nicht konnte, weil sie schlicht nicht existierten, dem wird hier eine kleine Liste geliefert. Manches Thema der unten aufgeführten Liste wurde in dem einen oder anderem (wissenschaftlichen) Beitrag schon behandelt. In einem solchen Fall sind wir zumindest der Ansicht, dass das Thema ausführlicher untersucht werden könnte. Ideal erscheint uns dafür zumeist die Buchform, das eine gewisse Menge an Wissen in passabler Form gesichert zu Verfügung stellt. Gäbe es diese Werke, so unsere Überzeugung, wäre das Bibliothekswesen und damit auch die Welt besser. Es ist also auch eine Liste für zu schreibende Arbeiten, Vorschläge für Abschlussarbeiten oder Alterswerke.
1. Read a m******* book: HipHop and the Public Library
Unverkennbar ist HipHop eine Kultur, welche eine Position besetzt, die einst von Literatur und Poetik eingenommen wurde: Jugendkultur, Ausdruck von Begehren, Aufbruch, Rebellion; Einfordern des Guten Lebens. Gleichzeitig ist HipHop in seinen besten Ausprägungen zutiefst poetisch: “But some things will never change / try to show another way / but you staying in the dope game / now tell me what’s a mother to do / being real don’t appeal to the brother in you / you gotta operate the easy way / I made a G today but you made it in a sleezy way / selling crack to the kids / I gotta get paid well hey well that’s the way it is.” (2Pac Shakur: Changes). Solche Einsichten und Poetiken lassen sich nur begreifen unter dem Einfluss harter Realität, eigenständiger Reflexionleistungen und der aktiven Auseinandersetzungen mit Literatur. Das Auftreten des HipHop in New York, späterhin anderen Metropolen der USA, legt die Vermutung nahe, dass der Zugang zur Literatur, der von dieser Kultur immer wieder bewiesen wird, auch über das System der Public Libraries realisiert wurde. Die Studie wird die Interdependenzen zwischen HipHop und Public Library untersuchen und aufzeigen, ob Öffentliche Bibliotheken Auswirkungen auf die Lyrikproduktion des HipHop hatten. Die Untersuchung ist vor allem historisch angelegt.
2. Stanisław Lem / Die Vierte Reise des Ijon Tichys
Bekanntlich enthalten die Aufzeichnung der Sternenreisen des Ijon Tichys Lücken, die damit gerechtfertigt sind, dass sie sowohl zeitlich als auch räumlich geordnet stattfinden und deshalb eine erste Reise nicht existieren kann. Wie Tichy allerdings in der achtundzwanzigsten Reise darlegt, können Lücken auch anders entstanden sein, insbesondere indem Teile der Aufzeichnungen noch unentdeckt in der schwarzen Ferne herumfliegen.
In der neu entdeckten vierten Reise berichtet Tichy vom Besuch im Kometennebel Entylan, genauer: bei den Iplonden. Die Iplonden haben vor Jahrmillionen den Plan entworfen, dass Wissen der Sterne zu sammeln und allgemeinverständlich aufzubereiten. Dabei weichen sie aus verständlichen Gründen – siehe die Erinnerungen Tichys an Professor A. Donda – auf die Speicherung der Information (nicht des Wissens) auf unbewohnten Planeten aus. Tichy besucht sowohl die Speicher- als auch Produktionsstätten und überzeugt sich von den Möglichkeiten der Sammlung, bedauert, dass sie nicht schon im 27., sondern erst im 31. Jahrhundert zur allgemeinen Verfügbarkeit stehen werden. Er schlägt die Einführung einer großzügigen Zugangspraxis vor, die im 34. Jahrhundert tatsächlich eingeführt wird.
(Lems Text ist selbstverständlich eine Kritik am Stalinismus, der Unlogik des Kapitalismus und dem mangelnden Umweltschutz.)
3. Sex and Pornography in Libraries
Dieses Werk, dass immer wieder vorgeschlagen, dann allerdings voreilig verworfen wird, lotet den Zusammenhang zwischen Erotika und Bibliotheken aus. Einerseits stellt es die Sammlungspraxis von Bibliotheken und die sich verändernden Aufgabenstellungen von Erotika-Sammlungen vor (wobei sowohl auf die Sammlungs-, Medienbeschaffungs- und Mediennutzungsgeschichte als auch die Rechtsgeschichte eingegangen wird). Andererseits thematisiert das Werk die Bibliothek als Ort von Erotika und Pornography und arbeitet eine theoretische Basis zum Verständnis des Begehrensortes Bibliothek aus, welche sowohl auf die Theorie des dritten Ortes, der Erotik des Verbots sowie die Anziehungskraft (vermeintlicher) Intellektualität eingeht. Im Anhang findet sich eine Biblio- und Filmographie aller Erotika, die einen direkten oder indirekten Bezug zur Bibliothek haben. Entgegen der Hoffnungen mancher Individuen ist dieses Buch höchst wissenschaftlich und objektiv.
4. Karsten Schuldt / Der Diskurs und der Katalog
In einer diskurstheoretischen Untersuchung wird der Bibliothekskatalog nicht, wie schon einige Male zuvor, als abstraktes Sprachsystem verstanden, sondern als Diskursobjekt. In den Katalog, so die Hauptthese des Werkes, sind nicht nur die bibliothekarischen und gesellschaftlichen Diskurse der jeweiligen Gesellschaft, in der eine Bibliothek existiert eingeschrieben. Vielmehr wirkt der Katalog gleichzeitig normierend auf den Zugang zu Wissen, den Ort Bibliothek und der Stellung der Bibliothek in der Gesellschaft. Die Untersuchung führt dies anhand einer Kataloggeschichte, beginnend in der frühen Neuzeit und endend bei FRBR und RDA, aus.
5. Chronik vergangener Medienhypes
Bibliotheken unterliegen gesellschaftlicher Hoffnungen. Regelmäßig wird die Behauptung erhoben, bestimmte neue Medien stellten eine Rettung von Bibliotheken dar und würden ihre Arbeit grundlegend ändern. Die Medien müssten in den Bestand aufgenommen werden, um überhaupt Nutzerinnen und Nutzer in der Bibliothek zu halten, gleichzeitig würden sie die bibliothekarische Arbeit grundlegend verändern. Die Chronik stellt diese Versprechen und Medien, ausgehend von frühen 18. Jahrhundert, objektiv vor. Der Band enthält zahlreiche historische Dokumente zu bibliothekarischen Debatten. Im Nachwort warnt die Herausgeberin explizit davor, alle neuen Medien als reine Hypes zu diskreditieren.
6. Bibliothekscafés: Organisation, Management, Wirkungen, Beispiele
Das Bibliothekscafe hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Bibliothekssystemen als Standardeinrichtung durchgesetzt, welche den sozialen Charakter von Bibliotheken unterstützen soll. Dabei ist nicht nur der Aufbau, sondern auch die Bedeutung der Bibliothekscafés äußerst unterschiedlich: Kleine Buchcafés, größter sozialer Treffpunkt kleiner Gemeinden, eines unter zahlreichen Cafés im Umfeld in größeren Städten. Einige dieser Einrichtungen werden kommerziell betrieben, andere von den Bibliotheken selber. Immer stellt sich die Frage, in welcher Beziehung des jeweiligen Cafés zu den restlichen Aufgaben der Bibliothek steht.
Das Buch gibt eine Übersicht zu Modellen der Bibliothekscafés, ihrer Planung und Leitung. Es ermöglicht die strategische Planung dieser Einrichtungen und liefert zahlreiche illustrierende Beispiele.
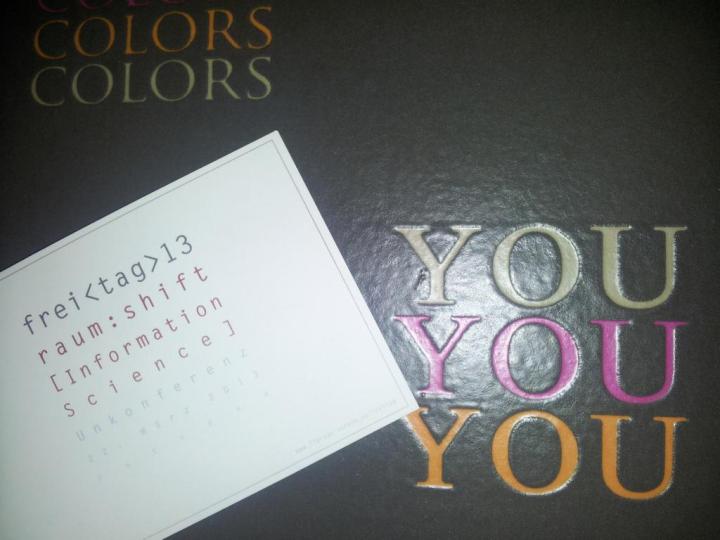
Ein Menschenleben vermag wohl ein wenig zu kurz zu sein, damit diese Liste von nur einem Autor oder einer Autorin abgearbeitet werden kann. Wenn wir behaupten, es würde der Bibliotheks- und Informationswissenschaft gut tun, a) etwas mehr Selbstreflexion zu betreiben und b) etwas mehr über den Tellerrand zu blicken sowie c) es gibt noch nicht genug Literatur von der Art, die man eigentlich zu unserem Fach lesen möchte, dann benötigen wir in erster Linie eines: Dich. Dein Engagement, Ideen und Kreativität sowie Erkenntniswille. Die müssen sich nun nicht unbedingt mit dieser Liste decken (was wir selbstverständlich begrüßen), aber du kannst wie aufgezeigt ein wichtiger Teil sein. LIBREAS im Allgemeinen und die frei13 im Besonderen ist der bunte Ort, um sich einander vorzustellen an deren Ende eventuell sogar Sympathie und gemeinsame Pläne stehen. Da ist es auch nicht wichtig wie viel davon umgesetzt wird, d.h. prozentual gesehen, wichtig ist nur, dass man sich auf Neues einzulassen bereit ist. Am Ende ist es immer noch besser 1 von 15 Büchern umzusetzen als gar keines oder nur ein Weiteres, das bereits etablierte Argumentationsschleifen bedient.
7. Neo-Kybernetische Manifeste
Eine These: Die Kybernetik hatte in ihrer Grundidee Recht, nicht aber in ihrer Ausführung. Offensichtlich war ihre Ausarbeitung zu unterkomplex, um die tatsächlichen Rückkopplungen und Kreisläufe der Gesellschaft zu untersuchen. Die technologische Entwicklung ist fortgeschritten, heute gilt es auszuloten, inwiefern die kybernetische Idee mithilfe moderner Rechner und Bibliothekssysteme dargestellt und umgesetzt werden kann. Die Manifeste werden diese Diskussion anstoßen.
8. Gruppe Weltbibliothek (Hrsg.) / Weltbibliographie. Entwurf einer umfassenden Bibliographie auf der Basis nationalbibliographischer Arbeit
Ein Aufruf, eine Streitschrift. Die nationalbibliographischen Arbeiten sind nur der Anfang, Ziel aller bibliothekarischer Arbeit muss die Weltbibliothek sein; eine Einrichtung, die im Netzwerk allen Menschen alle Informationen zur Verfügung stellt. Einer der wichtigsten Schritte hin zu dieser Einrichtung muss die Weltbibliographie sein. Die Gruppe Weltbibliothek und andere Persönlichkeiten des Bibliothekswesens liefern in dieser Schrift eine überzeugende Argumentation für diese These.
9. Akquise und De-akquise: Eine Soziologie des Bibliotheksbestandes
Während bibliothekarische Arbeiten bislang vor allem die praktische Planung des Bestandes und das Erarbeiten von Bestandsstrategien beschrieben, versteht diese Studie den Bestand von Bibliotheken als Ergebnis sozialer Prozesse. Der Bestand und seine Entwicklung wird als Untersuchungsobjekt genutzt, um, aufbauend auf organisationssoziologische und systemtheoretische Arbeiten, eine Theorie der Entwicklung des Bibliotheksbestandes aus gesellschaftlicher Perspektive zu entwerfen. Dabei wird der Anspruch erhoben, ausgehend von messbaren Faktoren (insbesondere die soziale Stellung der Fachreferentinnen und -referenten, dem Bibliotheksetat, der räumlichen Verortung der Bibliothek, des Bildungskapitals der Bibliotheksleitung und der Titelproduktion der lokalen Verlagslandschaft) die Entwicklung eines Bestandes für einen Zeitraum von zehn Jahren antizipieren zu können. Enthält Fallbeispiele.
10. Die Bibliothek aus Sicht bedeutender Systemtheoretikerinnen und -theoretiker
Systemtheoretikerinnen und -theoretiker der Gegenwart nehmen Stellung zur Bibliothek in Vergangenheit, im Jetzt und der Zukunft. Behandelt wird der Gegenstand der Bibliothek in Essays und Interviews. Darunter auch Zitate und Kommentare zur Institution Bibliothek von Systemtheoretikerinnen und -theoretikern, die leider nicht mehr ausführlicher befragt werden können. Der Band enthält Positionen zur gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und ökonomischen Verantwortung von Bibliotheken und nennt wichtige Momente und Anekdoten der mehr als zweitausendjährigen Bibliotheksgeschichte. Darin enthalten auch die Frage, wie die letzten zwei Jahrtausende sich entwickelt hätten, gäbe es die Bibliothek und ihre Möglichkeiten nicht. Verfügbar als Paperback sowie als Goldschnitt.
11. Die Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Osteuropa: Einblicke, Perspektiven, Erkenntnisse
Erkenntnisse und Inspiration bezieht die Bibliotheks- und Informationswissenschaft in den D-A-CH-Staaten gern aus Regionen wie Skandinavien, Großbritannien, Australien oder den USA. Ziel dieses Sammelbandes ist es, sich der osteuropäischen Informationsbranche anzunehmen. In einer Vielzahl an Beiträgen, unter anderem von Wissenschaft und Praxis aus Polen, Russland, Kroatien oder Lettland werden Typen, Besonderheiten und Wege, Wissen zu normieren, dargestellt. Zudem liefert dieser Band historische Bezüge und gibt einen Einblick in die schwierige Zeit sowie teilweise Neuaufstellung des Bibliothekswesens nach dem Zusammenfall des Ostblocks. Den Abschluss bildet ein Überblicksartikel, welche Theorien und weiteren Einflüsse die Bibliotheks- und Informationswissenschaft in der Osteuroparegion durch die Jahrhunderte über prägten.
12. Gegenwart und Zukunft der Bibliothek: ein Dialog zwischen Expertentum und Laiensicht
Dieses Werk wagt einen Versuch: bedeutende Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Informations- und Bibliothekswissenschaft debattieren in Form schriftlicher Dialoge über den Gegenstand der Bibliothek – jedoch mit Laien und Laiinen. Darunter aus Bibliotheks- und informationswissenschaftlicher Sicht fachfremde Menschen wie der Regionalpolitik, Wirtschaft, Lernenden sowie Lehrenden, jemand der erst an seinem Lebensabend die Bibliothek für sich entdeckte sowie ein Meister im Fach der Gas- und Wasserinstallation. Als ein Highlight sei hier der Dialog mit einer Gruppe von Kindern und einem emeritierten Professor vorgestellt, die sich gemeinsam dem Ideal einer Bibliothek anzunähern versuchen. “Mehr zuhören”, so die Prämisse des Werkes. Alle Dialoge liegen als Ausschnitte in Videoform auch auf der Webseite bereit. Nicht nur für das Fach ist dieser Versuch sehens- sowie lesenswert. Kommunikations- und Transferwissenschaft dürften ebenso profitieren.
13. Die Süchte der Bibliothekare, die Laster der Bibliothekarinnen
In der gesellschaftlich etablierten Sicht auf die Bibliothekarinnen und Bibliothekare dieser Welt sind diese mitnichten mit einem Rockstar-Image behaftet. Sie gelten schon eher als leicht spießig, zurückhaltend und als wüssten sie nicht wie man als Mensch mal richtig entspannt. Das kleine Essay sucht nicht nur nach den Ursachen dieses Bildes, sondern erkundet auch eine Reihe der Laster mehr oder weniger bekannter Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Ferner behandelt dieser Text die Frage, wie oft das Personal von Bibliotheken es wagt, in neue Bewusstseinszustände zu transzendieren und welche Mittel sie häufig dazu einsetzen. Zudem werden Einblicke in die Sehnsüchte, intime Gedanken und einschneidende Erlebnisse in jungen Jahren, kurz vor der Berufswahl, gegeben. “In der Bibliothek arbeitet man nicht zufällig”, so die übergreifende Behauptung des Essays. Psychologisch fundiert und mit einigem empirischen Material im Anhang wird diese Behauptung überprüft. Eine zugegeben nicht ganz ernst gemeinte Tabelle des richtigen alkoholischen Getränkes zur jeweiligen Literaturgattung (mit Beispielen) findet sich in der Mitte des Buches.
14. Bibliotheks- und informationswissenschaftliche Erkenntnisse und ihre Verwendung in anderen Disziplinen
Dem Fach wird bisweilen unterstellt, Methoden und Erkenntnisse anderer Disziplinen zu nutzen ohne in gewinnbringender Relation theoretische sowie praktische Aussagen für jene Disziplinen in umgekehrter Richtung zu liefern. Aber stimmt das? Das Handbuch stellt zunächst entscheidende Einflüsse auf die bibliothekarische und informationswissenschaftliche Wissenschaft und Praxis, die sie maßgeblich aus anderen Disziplinen erhielt, vor und versucht dann, aus wissenschaftstheoretischer Sicht sowie bibliometrischen Analysen zu untersuchen, inwieweit das Fach auch andere Disziplinen beeinflusste. Das Werk ist geeignet für Studienanfänger und wissenschaftlich Tätige sowie ebenso für Akteurinnen und Akteure anderer Disziplinen. Am Ende wird anhand von Handlungsanregungen aufgezeigt, inwiefern die Wissenschaft im Allgemeinen künftig besser das Wissen anderer Disziplinen integrieren kann, sodass etwaige Ansprüche auf angemessene Reputation gewahrt bleiben.
15. Zum richtigen Verhalten in einer Bibliothek – ein Vademekum.
Den Raum irgendeiner bibliothekarischen Einrichtung zu betreten ist manchmal bedeutungsschwanger, jedoch oft genug an festen Regeln gebunden, damit die Interessen der verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer respektiert bleiben. Neben historischen Bezügen, welche die oft stillen Übereinkünfte in einer Bibliothek herleiten sind auch originelle Beiträge enthalten. Darunter: “23 Fehler, die alle in einer Bibliothek machen dürfen”. Des Weiteren unternimmt das Werk Vorstöße, um psychologische Motive wie Bibliotheksangst, Bibliomanie oder das AIBS des gemeinen Bibliotheksmitarbeiters beziehungsweise der gemeinen Bibliotheksmitarbeiterin begreiflich zu machen. Nichtzuletzt sind die Beiträge auch spannend für das Bibliothekspersonal im Allgemeinen, werden diese doch oft genug in die Perspektive mit einbezogen.
Berlin und Potsdam, 7. März 2013
It’s the frei<tag> 2013 Countdown (17): Wie wollen wir arbeiten?
von Karsten Schuldt
I have never found a companion that was so companionable as solitude. We are for the most part more lonely when we go abroad among men than when we stay in our cambers. A man thinking or working is always alone, let him be where he will. (Henry David Thoreau)
The nice thing about teamwork is that you always have others by your side. (Margaret Carty)
Im allerersten Countdown zur allerersten frei<tag> – das war gerade mal vor zwei Jahren, aber es fühlt sich an wie zehn oder zumindest achteinhalb – gab es einen Beitrag zu den Arbeitsplätzen der damals die Unkonferenz Organisierenden. Die These hinter diesem Beitrag war, dass die Arbeitsplätze und wie wir sie präsentieren, mehr über uns aussagen würden als zum Beispiel unsere Porträtphotos, Lieblingsmusik oder Hobbys. Ergebnis dieser Photos war unter anderem, dass die Computer, nicht die gedruckten Medien, im Mittelpunkt unserer Arbeitsplätze standen (genauer: auf den meisten Bilder gab es überhaupt keine gedruckten Medien und wenn, bezogen die sich kaum auf Bibliotheken). Ausserdem fiel auf, dass kaum jemand von uns direkt in Bibliotheken, viele hingegen in Wissenschaftseinrichtungen tätig war.
Was allerdings überhaupt nicht geklärt wurde, durch diese Bilder, war, wie wir eigentlich arbeiten wollten. Sicher: Wir konnten unsere Arbeitsplätze selber gestalten und ja, im Grossen und Ganzen sagten Sie uns auch zu. (Ich konnte zum Beispiel aus meinem Fenster täglich die Sonne über der grossen Synagoge in der Oranienburger Strasse untergehen sehen, während sich ihre Strahlen in deren goldenem Dach und der Spree brachen, gleichzeitig hörte ich die Touristinnen und Touristen, Studierende und Dozierenden unter meinem Fenster entlanggehen. What’s there not to like?) Aber: Wir konnten uns die eigene Arbeit und Arbeitseinteilung nicht aussuchen. Wieder mit einer gewichtigen Einschränkung: Diejenigen von uns an den Hochschulen haben selbstverständlich trotz allem mehr Freiheiten dabei die eigenen Arbeitsinhalte und -bedingungen zu bestimmen als andere. Freiheit der Wissenschaft und so.

Inetbib-Tagung 2013, Humboldt-Universität zu Berlin, Session zum Themenfeld Open Access, 04.03.2013. Versteckt auf dem Bild finden Sie (a) eine LIBREAS-Redakteurin/einen LIBREAS-Redakteur, (b) eine/einen aktuelle/n LIBREAS-Autor/in, (c) zwei intensive LIBREAS-Lesende. Finden Sie alle vier! (Tipp: Alle auf dem Podium. Open Access im Bibliotheksbereich und LIBREAS… Sie wissen schon. Gleich drei Redakteurinnen/Redakteure der Zeitschrift treten auf der Tagung auf, womit die Redaktion mit dem Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HU und dem Schweizerischen Institut für Informationswissenschaft, HWT Chur gleichzieht. Sacrebleu.)
Dennoch: Es wäre interessant zu wissen, wie wir eigentlich in Zukunft arbeiten wollen. Wenn wir über die Zukunft der Informationswissenschaft, der Bibliotheken und angrenzender Einrichtungen debattieren, debattieren wir auch über die dortigen Arbeitsbedingungen, wenn auch indirekt.
- Sagen wir zum Beispiel: Bibliotheken müssen 24 Stunden am Tag offen haben, sagen wir zumeist auch: Bibliotheken müssen 24 Stunden am Tag Personal haben. Dass heisst: Irgend jemand muss da um zwei Uhr an einem Donnerstag sein und irgendwer anders um Montag Morgen um fünf. Wollen wir das? (Oder lassen sich Bibliotheken so gestalten, dass sie zu bestimmten Zeiten staffless sind?)
- Oder: Wenn wir sagen, die Bibliothekswissenschaft sollte mehr ethnologische Methoden anwenden, heisst das auch, dass da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in langwierigen, systematischen Beobachtungsmethoden üben müssen. Wollen wir das?
- Oder: Wenn wir sagen, der Reference Service am Infodesk ist nicht mehr notwendig, wir brauchen Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die auf die Nutzerinnen und Nutzer zugehen, die hinter der Theke hervorkommen, die gar keine Theke mehr haben, heisst das auch, dass wir Bibliothekarinnen und Bibliothekare dazu nötigen, so zu arbeiten. Wollen wir das? Muss jede und jeder in der Bibliothek „etwas mit Menschen machen“?
- Wenn wir im Zuge der Debatten um RDA davon ausgehen, dass das Katalogisieren immer mehr eine kooperative Tägigkeit von Spezialistinnen und Spezialisten wird, heisst das auch, dass die Arbeit der Katalogabteilungen sich ändern wird. Sie werden weniger werden, mehr mit anderen Katalogabteilungen direkt kommunizieren etc. Auch hier: Wollen wir das?
- Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibliotheks- und Informationswissenschaft immer mehr zu einer Wissenschaft werden sollte, in der verteilt über Forschungseinrichtungen an Daten geforscht wird, dann wird sich die Arbeitsweise der Forschenden verändern: Weniger an einen Ort gebunden, wenig an die Bibliothek gebunden, viel unterwegs. Wollen wir das? (Geht das eigentlich: Eine Bibliothekswissenschaft, die den Ort Bibliothek nicht aufsucht?) Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass alle Forschung immer mehr Daten produziert und dass wir diese Daten verwalten sollten. Aber wollen wir das eigentlich auch für unsere Arbeit?
Man wird vielleicht nicht unbedingt Bibliothekarin oder Bibliothekar, Forschende oder Forscher weil man die Arbeitsbedinungen dieser Tätigkeiten schätzt; aber man wächst in sie hinein und findet sich mit der Zeit oft in ihnen zu Recht (oder wechselt fort, erstaunlich oft von der Forschung in die Bibliothek). Aber, wie uns die gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen der letzten 150 Jahre oder so gelehrt haben, sind die Arbeitsplätze und -bedingungen kein unabänderliches Schicksal. Wie wir arbeiten wollen bestimmt in einer langen Perspektive auch, wie wir am Ende arbeiten. Manchmal setzt man Bedinungen direkt durch, manchmal durch „Einschleifen“, machmal schafft man es nicht.
Aber:
- Wieviel wollen wir eigentlich in unser Arbeit mit anderen Menschen, mit Daten, mit welchen Medien, mit welchen anderen Einrichtungen zu tun haben?
- Wie lange wollen wir arbeiten, zu welchem Lohn, mit welchen Freiheiten?
- Wollen wir dem Kult der Alleinarbeit, der Teamarbeit oder keinem von beiden fröhnen?
- Wollen wir sichere Arbeitsverhältnisse oder spannende, wechselnde Aufgaben? Wollen wir an einem Ort bleiben oder viel unterwegs sein?
- Wollen wir Serviceorientiert sein oder mehr Erkenntnisorientiert?
- Wollen wir Jobs und nebenher Freizeit oder wollen wir Aufgaben, die uns ganz ausfüllen?
- Ist uns egal, wie die anderen in unseren Einrichtungen arbeiten, z.B. die Wachfrau früh um zwei, oder nicht?
- Wie werden wir nennen was wir machen? (Hier: Desletztens nannte jemand, was ich mache, „Privatgelehrtentum“ und nicht Wissenschaft, ganz explizit getrennt. Das ist schon interessant. Sind das unterschiedliche Dinge? Macht z.B. die Kollegin Kindling mit ihren Forschungen zu Repositorien und Open Access Wissenschaft und ich nicht? Hat das Auswirkungen auf unsere Arbeit?)
Sehr oft wird die Zukunft von Einrichtungen und Forschungseinrichtungen diskutiert ohne über die damit einhergehenden Veränderungen der Arbeitsbedingungen zu diskutieren. Das Ergebniss ist dann oft, dass die Veränderungen auch deshalb nicht eintreten, weil die Beschäftigten sich ihre Arbeitsleben anders vorstellen und z.B. nicht auf die Informationstheke verzichten wollen. Deshalb sollten wir nicht vergessen, uns auch darüber zu unterhalten.
Potsdam, März 2013
It’s the frei<tag> 2013 Countdown (20): Steile Thesen, mehr Diskussionen
von Karsten Schuldt
Je planmässiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen. (Friedrich Dürrenmatt)
Mit der frei<tag> 2013 wollen wir unter anderem die Zukunft der Bibliotheks- und Informationswissenschaft ausloten. Die Zukunft, das wissen wir alle, ist ein Konglomerat aus dem, was man entwirft, dem, was von anderen entworfen wird, den pfadabhängigen Entwicklungen und Machtkämpfen in Institutionen und Gesellschaft sowie unerwarteten Ereignissen. Oder anders: Sie ist nur zum Teil verständlich, nicht einfach planbar, aber auch nicht zufällig. Was auf jede Zukunft vorbereitet, ist ein Verständnis des Gegebenen und eine Ahnung davon, was man haben will. Ansonsten wird die Zukunft keine Zukunft sein, sondern etwas, dass über einen hereinbricht. Die Zukunft wird anders sein als das Heute, aber auch nicht unabhängig sein davon. Was wir heute entscheiden wird Einfluss haben; was wir heute verwerfen wollen kann in Zukunft verworfen sein.
In der Managementsprache kommt oft der Begriff der strategischen Planung vor. Das ist selbstverständlich verwirrend: Strategische Planung klingt danach, als würde alles so kommen, wie man es plant, wenn man nur den Überblick behält, einen klaren Plan macht und proaktiv an seiner Umsetzung arbeitet. Aber: Dabei kann man sich immer verrechnen, wichtige Einflüsse übersehen, über- oder unterschätzen, sich zu sehr auf den Zufall verlassen, den Einfluss des strategischen oder nicht-strategischen Handelns anderer falsch einschätzen. Napoleon zum Beispiel hatte falsch geplant, als er davon ausging, bei Waterloo die englischen Truppen geschlagen zu haben, wenn die preußischen eintreffen würden. Wir wissen: Das stimmte nicht. Aber: Dank seiner Planungen ist Napoleon überhaupt mit Truppen bis nach Waterloo gekommen. (Und immer noch ist das Rätsel offen, ob ein vereintes Europa unter Frankreichs Aufklärung wirklich ein schlechte Option gewesen wäre. Das ist bei anderen Europaeroberungsplänen anders.) Die strategische Planung ist auch nicht vollständig falsch kann uns das lehren.

Oder es könnte auch sein, dass die Welt wirklich untergeht, der Sommer zum Winter wird, die Tage zu Nächten, die Nächte zu Zeiten des allgemeinen Chaos. Sich in den Alpen zu verkriechen könnte da eine Strategie sein, aber wer den gesamten Dürrenmatt gelesen hat, weiss, dass auch das keine wirklich gute Strategie ist. Wenn die Welt untergeht und selbst auf die Schweiz Atombomben fallen, werden Bücher zu Feuermaterial. Dennoch: Für einige Tage oder Wochen mag der Weg in die Berge, hinauf mit den letzten fahrenden Bahnen, hindurch den Schnee und Niederschlag von dem man nicht weiss: Ist er gut oder schlecht? Was verbirgt sich darunter? eine Hoffnung bieten. Eine trügerische. Aber, wieder Weltliteratur, das Decamerone zeigt ja auch, dass diese kurze Hoffnung genossen werden kann. If you have to go, why not with a Boom?
Andererseits wird man es vielleicht verdammen, dass man damals lieber Bücher las und über die Anwendbarkeit der Foucaultschen Diskursanalyse auf reine Datenmengen stritt, wenn man hätte das Skifahren erlernen können.
Hier nun ein Aufruf: Wir, als Wissenschaftscommunity aber auch als Bibliothekswesen, sollten die Zukunft nicht über uns hereinbrechen lassen; auch wenn wir wissen, dass eine Planung immer etwas schief geht. Das Planen anstossen tun sehr oft intensive und heftige Diskussionen. Heftige Diskussionen werden sehr oft von steilen Thesen und grossen Behauptungen angeregt, gegen die man sich offen zu verwehren oder denen man heftig zuzustimmen müssen glaubt. Deshalb: Steile Thesen für die Massen! Offen zur Diskussion gestellt.
- Auch in zwanzig Jahren werden die Bibliotheken sich gegenseitig erzählen, dass sie sich der Zukunft stellen müssen und dabei immer noch die ähnlichen Angebote machen, wie heute. Die Entwicklung wird nur langsam vorangehen, durch das mangelnde historische Bewusstsein des Bibliothekswesens wird es aber so aussehen, aber sei man „gerade jetzt erst“ dabei, sich zu verändern.
- In der Bibliothekswissenschaft wird sich in den nächsten zehn Jahren eine starke sozialwissenschaftliche Strömung etablieren, während die Informationswissenschaft sich weiter in Richtung Informatik orientieren wird. Das wird beklagt, aber nicht verändert werden.
- Die Ethnologie wird zu einer Leitwissenschaft der Bibliothekswissenschaft werden.
- Das Forschungsdatenmanagement und das, was heute als „Big Data“ diskutiert wird, wird nicht von den Bibliotheken, sondern von neuen Einrichtungen betrieben werden.
- Es wird insbesondere im Bezug auf Open Government Data ein gesellschaftliches Interesse daran geben, dass eine Einrichtung mit der gesamten Gesellschaft zusammen beginnt, darüber zu diskutieren, was man mit all den Daten eigentlich anfangen kann. Bibliotheken werden diese Chance, die behauptete Informationskompetenz zu beweisen, vorüberziehen lassen.
- In zehn Jahren wird dem Bibliothekswesen klar geworden sein, dass die Behauptungen (a) Informationskompetenz wäre gesellschaftlich wichtig, (b) Informationskompetenz wäre vor allem Recherchefähigkeit und (c) Bibliotheken würden Informationskompetenz fördern, ausserhalb der Bibliotheken kaum ernstgenommen wird. Das Bibliothekswesen wird sich dann zu fragen beginnen, ob These (a) und (b) überhaupt stimmen und sich in diesen Diskussionen verfangen, während die Gesellschaft diese Diskussion weiter ignoriert.
- Schulbibliotheken werden sich in den nächsten zehn Jahren in den deutschsprachigen Staaten endgültig als eigenständige Bibliotheksformen etablieren und eine Professionalisierung beginnen. Es wird eigenständige Schulbibliotheksverbände geben, die sich dagegen verwahren werden, das Schulbibliotheken als Sonderformen Öffentlicher Bibliotheken verstanden werden.
- Ein tief differenziertes System von Bibliotheksfilialen, die zentrale Dienste zentral organisieren, gleichzeitig den lokalen Anforderungen angepasst sind, wird in zehn Jahren als zukunftsträchtig gelten. Eingliedrige Bibliothekssysteme und grosse Zentralbibliotheken werden als hauptsächlich negativ beschrieben werden. Es wird der Vorwurf erhoben werden, dass die grosse Konzentration von Bibliotheken seit den 1990er Jahren dem Niedergang des Bibliothekswesens Vorschub geleistet hätte.
- In zehn Jahren werden wir wieder mehr französischsprachige Fachliteratur lesen und mit den Kolleginnen und Kollegen in Frankreich, der Romandie, Quebec und zahlreichen französischsprachigen Staaten in intensiven Austausch treten. Das wird das deutschsprachige Bibliothekswesen offener und interessanter machen. In zwanzig Jahren wird ähnliches mit dem Spanischen passieren.
Zürich, März 2013
It’s the frei<tag> 2013 Countdown (28): A long time ago, in a galaxy far, far away.
von Christoph Szepanski und Karsten Schuldt
„Der Mensch sollte sich besser bemühen, selber intelligent zu werden.“ (Stanisław Lem)
„You were the chosen one!“ (Obi-Wan Kenobi)
Episode IV
Die Zukunft, der Weltraum, der Ozean: Offen, voller Abenteuer, unerwarteter Wendungen. Auch voller Gefahren. Doch auch das normale Leben ist voller Gefahren, ohne das es neue Welten aufschließt, neue Erfahrungen machen lässt, neue Horizonte erreicht. Das was ist, der Status Quo, ist immer ein wenig unbefriedigend; insbesondere wenn wir wissen, dass da draußen ein Raumschiff auf uns wartet: Enterprise oder Rebellenflotte, X-Wing oder Millenium Falcon, Sputnik oder Curiosity. Und mit dem Raumschiff wartet neues Wissen auf uns. Wissen, Erkenntnis, Reflexion.
Sicherlich: Das Raumschiff ist uns hier eine Metapher für die Wissenschaft; der Status Quo bleibt aber Status Quo. Es geht immer irgendwie weiter, aber manchmal ist uns das nicht schnell genug, erst recht nicht weit genug. Zu oft haben wir das Gefühl, dass unsere Wissenschaft und die Praxis, auf die sie sich bezieht, sich in etwas zu kleinen Kreisen dreht. Denn das reine Kreisen bringt nichts.
Wenn man das Gefühl hat, dass es nicht weiter geht, muss man manchmal aufbrechen; die Sachen packen; den Warpantrieb bedienen; den Fortschritt mit tiefster Leidenschaft vorantreiben. Das kann schief gehen, besonders auf individueller Ebene. Hat man Pech, sitzt man nach einigen Sprüngen auf einem einsamen Mond fest, hat das Handtuch verloren oder auch den Babelfisch. Aber, zumindest wenn man nicht leise war, steht was man gesehen hat auf dem Weg im Anhalter durch die Galaxis verzeichnet und hilft den anderen Anhalterinnen und Anhaltern weiter zu kommen. Der gesamtgesellschaftliche Fortschritt beginnt zumeist mit einer persönlichen Reise – oft genug ins Unerwartete, nicht selten Unbequeme. Hauptsache man hat gewagt.
Möglich, dass uns da der Untergang erwartet. Aber wir wissen auch: Wenn es am unendlich Unwahrscheinlichsten ist holt uns die Herz aus Gold an Bord (was wieder eine Metapher ist, für den rettenden Artikel, das unerwartete Stückchen Text, dass unser Denken noch einmal vor dem Absturz rettet). Zaphod lässt uns nicht im Stich. Die Neugierde treibt uns weiter, dorthin, wo noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat.
Und wir möchten nicht alleine sein auf dieser Reise. Vielmehr:
Alle die wollen, sollen mitkommen können und sind dazu aufgerufen sich aktiv zu beteiligen (denn ohne Euch geht es nicht). Alle sollen an Bord kommen können. Kostenfrei natürlich. Wir wollen eine Nautilus anbieten. Durchs Wasser, durchs All, durchs Wissen. Ihr sollt den Weg mitbestimmen.
Episode V
Unsere These ist erst einmal, dass es der Bibliotheks- und Informationswissenschaft gut bekommen würde, wenn sie sich nicht nur selbst bespiegelt, sondern einmal mehr radikal durchgeschüttelt wird. Streitet sich denn niemand mehr richtig? Tritt denn niemand mehr laut auf und sagt, dass alles besser oder anders werden muss? Bezieht sich niemand mehr auf Andere? Ist es egal, was die Anderen in unserem Feld sagen?
Kein Tank Girl fährt durch unsere Gefilde. Oftmals scheint es fast so, als ob wir in einem Quasi-Paradies leben. Manchmal bedroht, aber auch nie so richtig. Sicher: Input kann zuweilen unerwartet von außen kommen. Tscheljabinsk kann gerade etwas darüber erzählen – und vielleicht können uns die Trümmer demnächst etwas über das frühzeitliche Sonnensystem mitteilen.
Unsere These ist weiter, dass ein Durchstarten dazu führen kann, dass die gesamte Wissenschaft sich neu findet. Nicht mehr nur im Nebeneinander von unterschiedlichen Modellen und Methoden, sondern in einem neuen Netzwerk mit neu artikulierten Rollen und neuen, langfristigen Forschungsprogrammen sowie Transdisziplinarität an deren Ende im Idealfall die Integration universeller Erkenntnisse für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft steht.

„I would also like my own flag made for me, one with the evolution of man, except with me at the end of the line! Oh, and I would also like my own ice cream parlor. There’s never an ice cream stand around when you really need one. Oh! And it better goddamn well have chocolate chocolate chip! God help you if you don’t have chocolate chocolate chip!“ (Dr. Insano)
Episode VI
In jeder guten Geschichte, die nach dem ersten Untergang der Menschheit spielt, gibt es jemand, eine kleine Gruppe, die sich wieder ins Freie traut. Stalker läuft in die Verbotene Zone, trotz allem Ungemach geht Paul Atreides in die Wüste zu den Freemen, George Taylor läuft und läuft und läuft, bevor er vor der Freiheitsstatue zusammensinkt und der Neomensch Daniel25 gibt sein gesichertes pflanzenartiges Dasein für einen Flirt in der atomaren Ödnis auf. Wer nicht losgeht erlebt keine Abenteuer lehrt uns das. Wer nicht losgeht kann schnell untergehen, im Ewig gleichen verharren, ohne etwas unternommen zu haben.
Wir wollen das nicht. Wir wollen fröhlich und offen und so punkig-vorwärtstreibend wie möglich einladen: Zu einer weiteren Unkonferenz. Die frei<tag> – raum:shift [information science] soll – metaphorisch gesprochen – unser Raumschiff sein, dass uns weiter und weiter durch den Raum trägt, dass uns andocken lässt an so unterschiedliche Raumstationen wie die Diskursanalyse, die Informatik, die Sozialwissenschaften, die Kognitionswissenschaft, die Mathematik und nicht zuletzt die Systemtheorie(en). Dieses Raumschiff – zwischengeparkt am Rand Potsdams -, ist offen. Hört die Signale.
Es wird den Funk bringen wie das Mothership. Wir laden alle Irritierten und Interessierten ein, vorbeizukommen und mit uns zu schauen, wie weit wir kommen. Und vorher versuchen wir zur Einstimmung auf die Zukunft unserer Zunft zu verweisen. Wie gesagt: Manche Sprünge, sagt Wang-lun, sind nicht weit, bringen aber die Welt in eine neue Phase.
Wir brauchen vielleicht keine neue Kritik des immer wieder Alten, keine Forderung dessen, was wir schon haben, nochmal und noch mehr zu haben. Wie gesagt: Die Zukunft, der Weltraum, der Ozean sind offen. Offen für das Scheitern, offen für neue Erkenntnisse, offen für das Ausprobieren. (Und ja, am Ende, wenn der Große Bruder regiert hat, wenn die letzten Angriffe geflogen, die letzten Pläne umgesetzt, die letzten Orte erreicht sind, wird uns die Liebe retten. Die Liebe (zur Weisheit), sie bleibt am Ende, egal wo wir landen und als was.)
Potsdam und Chur, 22.02.2013


leave a comment